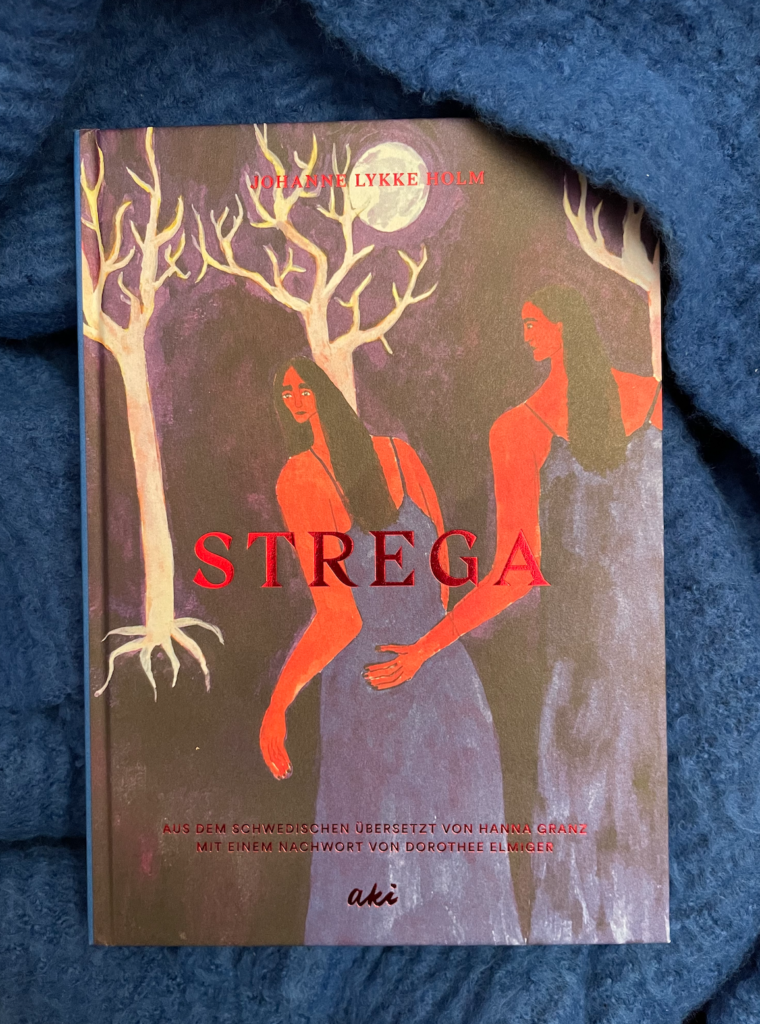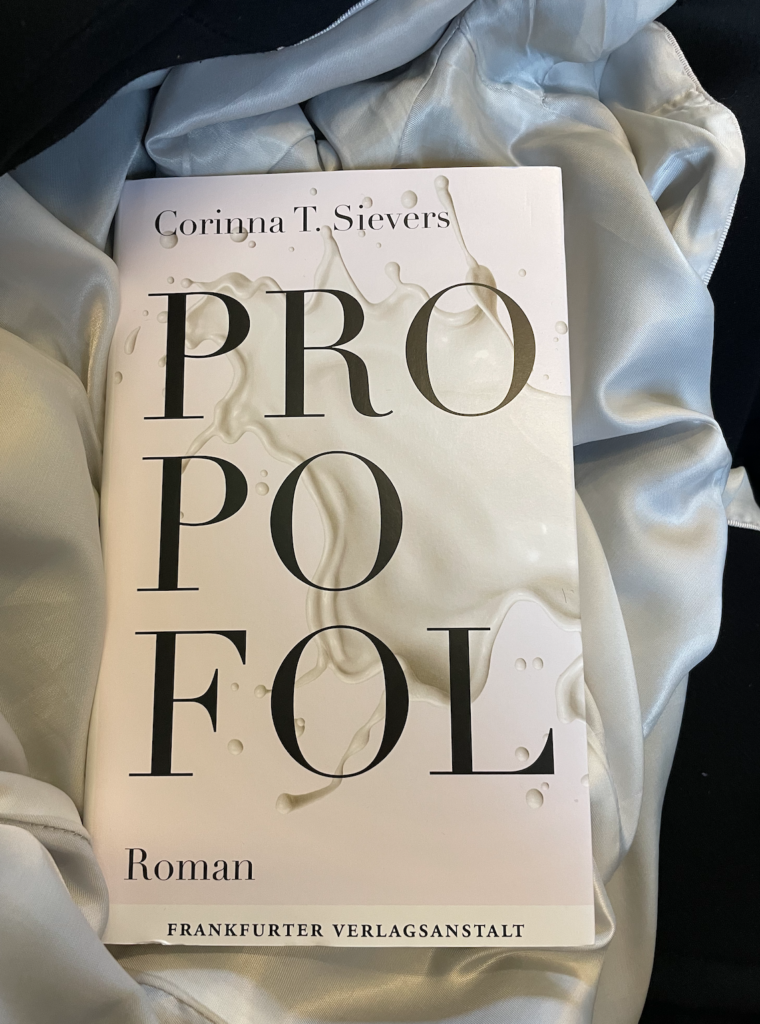„Man muss Abstriche machen, wenn man Geld verdienen will“
Wie viel Geld ist genug? Das hat Mareice Kaiser ganz unterschiedliche Menschen gefragt: solche, die Geld haben, und solche, die keines haben. Wie viel Kapitalismus ist genug?, könnte auch eine Kernfrage des neuen Buchs der Journalistin und Autorin lauten, die sich mit Armut, Reichtum und der Verteilung von beidem beschäftigt hat. Ihr Zugang ist dabei ein persönlicher, denn mit Geld fühlt sie sich unwohl. Sie kommt aus einer Arbeiterfamilie, hat nie studiert, hat nie die Codes gelernt, die man braucht, um sich in feinen Restaurants, im Theater, in teuren Hotels bedenkenlos zu bewegen – und das macht was mit ihr. Was genau, wollte sie untersuchen, und sie hat sich ihrer eigenen Herkunftsgeschichte gestellt. Wie ist das, wenn nie Geld da ist, welches Verhältnis bekommt man dann dazu? Von diesem Ausgangspunkt hat sie sich auf die Suche gemacht nach Leuten, die verbeamtet sind oder Flaschen sammeln müssen, um über die Runden zu kommen, die viel verdienen oder wenig – und hat mit ihnen gesprochen. Wer sollte mehr Geld haben? Und was würde das verändern?
Ich mag es, dass Mareice Kaiser so schreibt, dass alle verstehen können, worum es geht. Das ist gerade bei einem solchen Thema wichtig, denn allzu oft wird über Wirtschaftssysteme, Umverteilung und Kapitalismus auf einem Niveau gesprochen, wo nur noch wenige folgen können – dabei ist jede:r Einzelne von uns betroffen. Ich hab diese Geschichten gern gelesen und selbst intensiv über mein Verhältnis zu Geld nachgedacht, das immer schon eher ungewöhnlich war, weil ich in meinem ganzen Arbeitsleben nie fest angestellt war. Wichtig ist aber nicht nur, dass wir nachdenken, sondern auch, dass wir miteinander reden – viel offener, als wir das bisher tun. Es heißt ja, das Tabu, nicht zu sagen, wer wie viel verdient, soll das Ungleichgewicht verbergen: Damit Menschen, die weniger bekommen (etwa Frauen), das nicht merken. Lasst uns das ändern! Dieses Buch macht den Anfang.