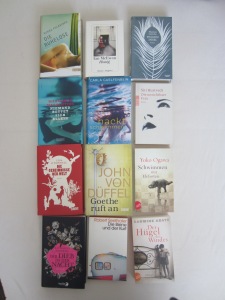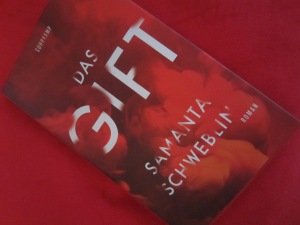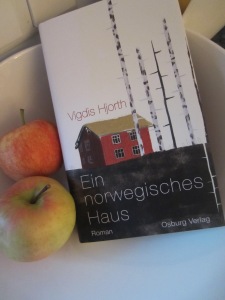Und dann nicht aufgeben, niemals, nie
Und dann nicht aufgeben, niemals, nie
Als der junge Ungar Miklós 1945 aus dem Konzentrationslager befreit wird, besteht er im wahrsten Sinn des Wortes nur noch aus Haut und Knochen. Er wird nach Schweden gebracht, zusammen mit vielen anderen, und dort medizinisch betreut. Dabei stellt sich heraus: Miklós leidet an einer Lungenkrankheit und hat nur noch sechs Monate zu leben. Doch davon lässt er sich nicht beirren. Er schreibt 117 Briefe an junge ungarische Frauen, die über ganz Schweden verteilt sind, denn er möchte antworten. Allzu viele Antworten bekommt er nicht, doch sehr schnell ist für ihn klar: Lili soll es sein, sie ist die Richtige. Es entspinnt sich ein intensiver, emotionaler Briefwechsel, und Miklós setzt alles daran, seine Lili persönlich zu treffen. Nichts soll ihn davon abhalten, nicht einmal sein nahender Tod …
In Fieber am Morgen erzählt Péter Gárdos, preisgekrönter Film- und Theaterregisseur aus Budapest, die wahre Geschichte seiner Eltern. Miklós und Lili haben also tatsächlich gelebt, und all diese Briefe wurden wirklich geschrieben. Das macht dieses Buch umso schöner und gibt ihm mehr Tiefgang. Dem Autor ist es ausgezeichnet gelungen, aus den realen Anknüpfungspunkten Fiktion zu weben und all das, was er nicht weiß, mit seiner Fantasie auszufüllen. Dabei bezeichnet er Miklós das gesamte Buch über konsequent als „meinen Vater“, seine Mutter aber als Lili. Wer der eigentliche Erzähler ist, ist somit klar, und freilich auch, dass die Geschichte ein gutes Ende haben wird, denn sonst wäre Péter gar nicht erst geboren worden. Das Hauptaugenmerk liegt auf Miklós, aber auch Lili hat eine eigene Perspektive in diesem gefühlvollen Roman. Die beiden kämpfen gegen allerlei Hindernisse, die vor allem aus Bürokratie und neidischen Menschen bestehen – und in der tödlichen Krankheit, an der Miklós leidet. Sie kämpfen darum, nach allem, was sie erlebt und gesehen haben, weiterzuleben, gemeinsam.
Es ist sagenhaft, wie stur Miklós an seinem Plan festhält, sich nicht unterkriegen zu lassen, von nichts und niemandem. Liegt das daran, dass er die schlimmsten Gräueltaten überlebt und nichts mehr zu verlieren hat? Es fasziniert mich, wie er aus einem simplen Briefwechsel eine Liebe kreiert und formt – allein mit der Kraft seines Glaubens daran. Er WILL, dass Lili seine große Liebe wird, und allein deshalb wird sie es auch. Die Worte, die Péter Gárdos für seine Erzählung verwendet, sind schlicht und ehrlich, sie verstellen sich nicht, putzen sich nicht heraus, und sie sagen immer, was sie meinen. Raffiniert ist das nicht, aber wunderbar zu lesen – und es passt perfekt zum Inhalt dieser einzigartigen, sehr klaren und sehr menschlichen Story. Ich habe mir sagen lassen, dass Fieber am Morgen vom Literarischen Quartett als Holocaust-Kitsch verunglimpft wurde und frage mich, ob es so etwas überhaupt geben kann – wenn das Buch noch dazu auf wahren Tatsachen beruht. Ein solches Buch muss nicht literarisch herausragend sein, weil seine Kraft auf der Wahrheit beruht, auf der Geschichte unserer Länder, auf liebevollen Briefen, auf unbeugsamem Überlebenswillen. Und Péter Gárdos driftet nie ins Kitschige ab, denn er betont, dass seine Eltern im späteren Leben nie romantisch waren, dass sie aus ihrem ungewöhnlichen Kennenlernen nie eine große Sache gemacht haben. Sie haben einfach gelebt, und das war genug.
Fieber am Morgen von Péter Gárdos ist erschienen im Hoffmann und Campe Verlag (ISBN 978-3-455-40557-6, 256 Seiten, 22 Euro). Rezensionen zum Buch findet ihr zum Beispiel auf Zeit.de, Papiergeflüster sowie Leseschatz.