 „Das Land hat kein Gewissen. Wenn man den Menschen ihre Träume nimmt, haben sie auch kein Gewissen mehr“
„Das Land hat kein Gewissen. Wenn man den Menschen ihre Träume nimmt, haben sie auch kein Gewissen mehr“
Ich habe keine Ahnung, wo Altglück ist. Anscheinend ist das ein zutiefst abgefuckter Ort irgendwo bei euch in Deutschland. Anscheinend gibt es dort Chemiefabriken, stillgelegte Gelände, Säufer, Drogenköche und allerlei Leute, mit denen man es sich nicht verscherzen sollte. Ausgerechnet dorthin verschlägt es Richard Dunkel – eigentlich auch so ein Typ, dem man nicht im Finstern begegnen will, aber offenbar einer von den Guten. Er war Söldner, schleppt die Bilder, die er nicht vergessen kann, und die Traumata, die er erlitten hat, mit sich herum. Ein schweigsames Kerlchen, ich stell ihn mir verkniffen vor, mit Zigarette im Mundwinkel, voller Falten und Narben. Er soll Wache schieben, weil ein zehnjähriger Junge verunglückt ist – nur ist von Anfang an klar, dass das kein Unglück war. Da hat jemand nachgeholfen: Die Drogenmischer rund um Tankstellenbesitzer Achim. Der will das große Geld, träumt von einem besseren Leben. Skrupel kennt er keine, das bekommt auch seine Geliebte zu spüren. Und Marie, deren Tochter, die – weil sie jung ist und hübsch – ins Visier der Männer gerät. Aller Männer, um genau zu sein.
Nie zuvor habe ich am Entstehungsprozess eines Romans so teilgenommen wie an diesem. Seit ich Sven Heucherts in Asche versammelte Geschichten gelesen habe, sind wir in Kontakt. Ich weiß um die Herausforderungen, die er für Dunkels Gesetz gemeistert hat, um die Ideen dahinter, die Beweggründe für manche Entscheidung. Das Buch schlussendlich in seiner fertigen Form zu lesen, war ein merkwürdiges Gefühl: Stolz war dabei und Erstaunen, manches zufriedene Nicken, aber auch das eine oder andere Kopfschütteln. Eins ist klar: Dunkels Gesetz ist kein Buch für jedermann. Es ist auch kein Buch, das sich in eine Schublade stecken lässt. Das hätte dem Verlag bewusst sein müssen, als er einen Krimi genannt und damit komplett falsch gelabelt hat. Das ist kein Kriminalroman, Punkt. Natürlich verstehe ich, dass man im Klappentext mit Schlagwörtern um sich werfen muss, das ist auch okay, nur weckt die Inhaltsangabe eine falsche Erwartungshaltung – und es ist nicht die Schuld des Buchs, wenn diese nicht erfüllt wird. Zudem war es meiner Meinung nach eine schlechte Marketingentscheidung, den Roman so weit zu streuen – ohne darauf zu achten, wem er geschickt wird. Feenstaubblogger haben ihn ebenso bekommen wie Fantasy-Leser, und man merkt an den Reaktionen, dass sie ihn nicht verstanden haben: Das ist eben kein Buch für jeden.
Das mit dem Verstehen ist auch für mich so eine Sache: Ich habe große Schwierigkeiten mit den Dialogen. Ich spreche den Dialekt von Altglück nicht, ich habe keine Ahnung, was Wörter wie Zosse, Lulle, Bakschisch, ruppen oder Druffis bedeuten. Manchmal kann ich es mir zusammenreimen, manchmal nicht, und dann sitz ich eben da und lese, ohne zu begreifen, was zur Hölle die da treiben. Sven Heuchert war in diesem Fall rigoros: Substandard zu verwenden, um den Lokalkolorit zu verdeutlichen, ist freilich völlig in Ordnung – oft aber folgt darauf ein Nebensatz, der das Gesagte erklärt. Nicht bei ihm. Ob der Leser es versteht oder nicht, ist ihm egal. Und das nehmen ihm viele Leser übel. Ich dagegen bin eine, die dann denkt: Okay, dann ist es mir eben auch egal. Ein bisschen schade ist es, weil ich natürlich schon gern gewusst hätte, worüber denn so geredet wird. Aber gut, das gehört zum Noir, zum Milieu, wie es heißt, die sogenannte Sprache der Straße. Und es ist halt eine andere Straße als meine.
Dunkels Gesetz ist, man ahnt es schon, dunkel. Düster. Brutal und hart. So gesehen ein echter Heuchert. Auch Asche war schroff und schwarz, aber viel literarischer. Das ist jedoch, denke ich, der Form der Kurzgeschichten geschuldet: Über einen ganzen Roman trägt ein solcher Stil nicht. Ein Roman braucht Fülle, braucht Klebstoff, um die einzelnen Stränge gut zu verbinden. Da hat Sven Heuchert gespart, das kann man nicht anders sagen: Dunkels Gesetz hat 180 sehr großzügig gesetzte Seiten und besteht aus Versatzstücken, aus Miniaturstorys, die zwar miteinander verknüpft sind, eigentlich aber auch für sich stehen könnten. Zum Teil haben sie wirklich gute letzte Sätze, an denen man sieht, was Sven kann. Dass dieses Verknüpfen eine schwierige Sache ist, merkt man aber auch am Gesamtinhalt: Der Handlungsverlauf ist schon arg vorhersehbar, da gibt es nichts beschönigen. Die Szenen entfalten ihre Wucht vielmehr im Einzelnen als der Roman als Ganzes. Man kann dem Autor eine solche Sturheit, die eigene Linie, die er sich gesetzt hat, zu verfolgen, vorwerfen, man kann ihn aber auch für seinen Mut bewundern. Er hat sich nicht verbiegen lassen, er hat es gemacht wie seine großen amerikanischen Vorbilder, die Raubeine, die mit Zigarette in der Hand und Whiskey vor sich auf einer Schreibmaschine hämmerten, die sparsam mit Worten waren und mit Erklärungen.
Dunkels Gesetz von Sven Heuchert ist erschienen bei Ullstein (ISBN9783550081781, 192 Seiten, 14,99 Euro).
 John Williams ist eine Wiederentdeckung. Sein Roman Stoner wurde erst posthum zum Welterfolg – Williams ist 1994 gestorben – und gehört heute zu den modernen Klassikern Amerikas. Es hat mich überrascht, dieses Buch über einen Farmerjungen, der an die Universität geschickt wird, um etwas über Landwirtschaft zu lernen, sich jedoch dann für die Literatur interessiert. Zu Arthur, dem Protagonisten in Nichts als die Nacht fand ich keinen so direkten Zugang, er ist ein irgendwie steifer Typ, gefangen in den eigenen Zwängen, vor allem im Konflikt mit dem übermächtigen Vater. Nun muss man wissen, dass John Williams Mitglied des Army Air Corps war und im Alter von 22 Jahren nach einem Flugzeugabsturz schwer verletzt im burmesischen Dschungel festsaß. Er hat dort wohl dem Tod ins Auge geblickt, und er hat dort dieses schmale Buch, sein erstes Buch, geschrieben über einen, der sich treiben lässt im Leben, der Konflikten ausweicht und sich doch eigentlich so viel wünscht. Das gibt der kurzen Erzählung eine intensive Kraft, und dennoch: Ich mochte Stoner lieber, viel lieber, wenn ihr also etwas von John Williams wiederentdecken möchtet, dann greift zu seinem Roman, der einem die Augen öffnet für das Gute im Alltag – und zwar auf völlig unesoterische Weise.
John Williams ist eine Wiederentdeckung. Sein Roman Stoner wurde erst posthum zum Welterfolg – Williams ist 1994 gestorben – und gehört heute zu den modernen Klassikern Amerikas. Es hat mich überrascht, dieses Buch über einen Farmerjungen, der an die Universität geschickt wird, um etwas über Landwirtschaft zu lernen, sich jedoch dann für die Literatur interessiert. Zu Arthur, dem Protagonisten in Nichts als die Nacht fand ich keinen so direkten Zugang, er ist ein irgendwie steifer Typ, gefangen in den eigenen Zwängen, vor allem im Konflikt mit dem übermächtigen Vater. Nun muss man wissen, dass John Williams Mitglied des Army Air Corps war und im Alter von 22 Jahren nach einem Flugzeugabsturz schwer verletzt im burmesischen Dschungel festsaß. Er hat dort wohl dem Tod ins Auge geblickt, und er hat dort dieses schmale Buch, sein erstes Buch, geschrieben über einen, der sich treiben lässt im Leben, der Konflikten ausweicht und sich doch eigentlich so viel wünscht. Das gibt der kurzen Erzählung eine intensive Kraft, und dennoch: Ich mochte Stoner lieber, viel lieber, wenn ihr also etwas von John Williams wiederentdecken möchtet, dann greift zu seinem Roman, der einem die Augen öffnet für das Gute im Alltag – und zwar auf völlig unesoterische Weise. „Nur vergessen will sie, schnell, alles“
„Nur vergessen will sie, schnell, alles“ „Denn manchmal sind Worte Brot, Wasser, Fleisch“
„Denn manchmal sind Worte Brot, Wasser, Fleisch“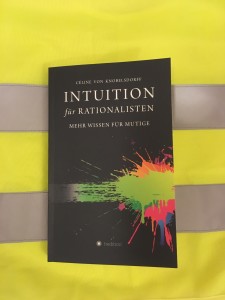 „Intuition ist die Stimme für unsere Selbst-Bestimmung“
„Intuition ist die Stimme für unsere Selbst-Bestimmung“ Ein Buch wie ein Mann
Ein Buch wie ein Mann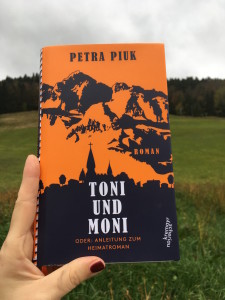 „Im Heimatroman gibt es eine gerechte Welt“
„Im Heimatroman gibt es eine gerechte Welt“ „Die Menschen wollen alles Schöne einfangen und wegsperren, um dann in Scharen herbeizueilen und mit anzusehen, wie es nach und nach verendet“
„Die Menschen wollen alles Schöne einfangen und wegsperren, um dann in Scharen herbeizueilen und mit anzusehen, wie es nach und nach verendet“ „Ein Abgrund tat sich unter uns auf. Wir klammerten uns aneinander und redeten uns ein, fliegen zu können“
„Ein Abgrund tat sich unter uns auf. Wir klammerten uns aneinander und redeten uns ein, fliegen zu können“ „Das Land hat kein Gewissen. Wenn man den Menschen ihre Träume nimmt, haben sie auch kein Gewissen mehr“
„Das Land hat kein Gewissen. Wenn man den Menschen ihre Träume nimmt, haben sie auch kein Gewissen mehr“ 16 Kurzgeschichten über Veränderungen im Leben
16 Kurzgeschichten über Veränderungen im Leben