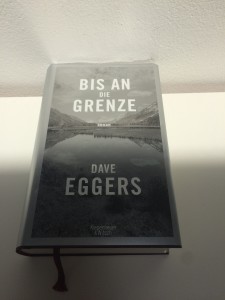 „Manchmal fordert ein Ort dich auf, zu bleiben, nirgendwohin zu hasten“
„Manchmal fordert ein Ort dich auf, zu bleiben, nirgendwohin zu hasten“
Josie ist Zahnärztin, hat aber nach einer Klage keine Praxis mehr. Josie ist Mutter, hat aber nach ihrer Scheidung keinen Mann mehr. Und weil sie plötzlich Panik bekommt, ihr Ex könnte ihr die Kinder wegnehmen, packt sie diese kurzerhand ein und flieht mit ihnen nach Alaska – das ist der einzige Ort, der ihr einfällt, der weit weg ist und für den sie keine Pässe brauchen. Also gurken Josie und ihre Kinder mit einem ranzigen Wohnmobil durch Alaska, ohne Plan, ohne konkretes Ziel, mit wenig Geld und wenig Geduld. Es kommt nicht so schlimm, wie es kommen könnte, aber richtig gut ist das alles auch nicht.
Bis an die Grenze von Dave Eggers ist ein selten dämliches Buch. Ich kann gar nicht glauben, dass der Autor, der für Romane wie The Circle und Hologramm für den König international mit Lob und Preisen überhäuft wurde, einen so schlechten Roman geschrieben hat. Wie ist das möglich? Hab ich mir einfach nur von all seinen bisherigen Werken das falsche ausgesucht? Dabei klingt das eigentlich interessant: Eine Mutter, die mit ihren Kindern auf der Flucht ist – die neu anfangen, sich neu sortieren muss, die sich wegen der Kinder nicht so von ihrem alten Leben lösen kann, wie sie es gern tun würde, die in der Weite Alaskas zu sich selbst findet. Bloß ist es das nicht. Protagonistin Josie ist eine wahnsinnig unglaubwürdige Figur, bei der ich mir eine Frage stelle, die für mich beim Lesen sonst nie eine Rolle spielt: Liegt es daran, dass Dave Eggers ein Mann ist? Kann er sich deshalb nicht in seine weibliche Mutterfigur hineinversetzen? Sie bleibt hölzern, unzugänglich, ist als Identifikationsfigur nicht mal ansatzweise geeignet. Es liegt nicht nur daran, dass Josie sich höchst merkwürdig verhält – es gibt schließlich keinen Standard für das Muttersein, es gibt eben Mütter, die machen es gut, und andere, die sind überfordert, all das ist menschlich, all das ist verständlich, all das ist nachvollziehbar. Allein: An Josies Handlungen ist überhaupt nichts nachvollziehbar. Dave Eggers stellt sie dar als eine Frau, die ihr Leben im Griff hat, da gab es die Praxis, die sie unverschuldet verloren hat, da gibt es ein Haus, Geld, Perspektiven, gesunde Kinder, keine Drogen, kein Alkohol (wobei Josie im Wohnwagen natürlich öfters Wein trinken muss, man hält das ja sonst nicht aus als alleinerziehende Mutter, grüß dich, Klischee, schön, dass du auch wieder da bist). Wir reden nicht von einer Familie, die völlig aus dem Lot gerät, nicht im Geringsten. Das Problem mit dem Vater der Kinder war, dass er ständig auf dem Klo saß. Kein Scherz. Wenn Josie an ihn denkt, sieht sie ihn auf dem Klo beim Pinkeln und Kacken. Das wird oft erwähnt, darauf reitet sie herum, und das macht die Vaterfigur einerseits lächerlich und nimmt andererseits jeglichem Konflikt den möglichen Tiefgang. Der Vater mit der schwachen Blase interessiert sich nicht für seine Kinder, sieht sie nie, ruft sie nie an. Aber wir sollen glauben, dass er Josie die Kinder wegnehmen will? Wir sollen es für realistisch halten, dass sie mit ihnen quer durch die Fremde fährt, sich und die Kinder in Gefahr bringt – ohne Grund? Das ist wirklich lahm.
Um Josies Verrücktheiten irgendwie zu erklären, zaubert der Autor plötzlich eine Kindheit aus dem Ärmel, die nicht ganz geglückt war, und das finde ich noch viel furchtbarer, weil: noch mehr Klischee. Zudem frage ich mich, ob er selbst Kinder hat bzw. die aufwachsen sieht, denn Ana und Paul – die Kinder im Buch – machen permanent unverhältnismäßige Sachen, die überhaupt nicht zu ihrem Alter passen. Es wirkt, als hätte ein kinderloser Mann sich gedacht: Ah, ich schreib mal über eine Mutter und ihre zwei Kinder, lasse alles einfließen, was ich über Mütter und Kinder so gehört habe, was soll schiefgehen? Alles!
„Anas niemals schwankendes Vertrauen in sich selbst, darin, wie ihre Gliedmaßen funktionieren würden, verriet, dass sie immer alles so machen würde, wie sie es für richtig hielt, und sich niemals fragen würde, ob es so richtig war – was bedeutete, dass sie Präsidentin werden könnte und garantiert immer glücklich sein würde.“
Ach nein! Vertrauen in meine Gliedmaßen bedeutet also, dass ich a) Präsidentin werden kann und b) immer glücklich sein werde? Eine Schlussfolgerung, die mir, gelinde gesagt, nicht unbedingt logisch vorkommt. Und so, meine Damen und Herren, klingt alles in Josies wirrem Hirn.
Am schrecklichsten aber finde ich, dass Dave Eggers derart langweilig schreibt, dass ich fast eingehe. So ein Roadtrip durch Alaska könnte spannend sein, inspirierend, aufregend, bei ihm ist er aber nur fad. Andauernd muss ich banalste Alltagsbeschreibungen lesen, die von Tanken über Autofahren bis hin zum Essen reichen:
„Ana hatte Hunger, also machte Josie sich auf die Suche. Sie fand Joghurt, und sie aßen zusammen einen Becher. Sie fanden Trauben und Cracker und aßen sie. Sie fanden Eier, und Josie machte Omeletts. Während Ana ihre zweite Portion aß, bemerkte sie das Schaukelgerüst im Garten und lief hin. Paul schlief noch, deshalb ging Josie wieder zum Kühlschrank, fand Schokoküsse und aß sechs von acht.“
Da schreit eine Stimme in mir schon: WEN INTERESSIERT DAS! Und: Weil Paul noch schläft, geht Josie wieder zum Kühlschrank? Konsekutivsätze, in denen das eine die Folge des anderen ist, sind anscheinend nicht so Dave Eggers’ Ding. Das gesamte Buch strotzt vor sprachlichen Schludrigkeiten. Das Feuilleton gibt daran zum Teil den Übersetzern die Schuld, was ich nicht fair finde: Wo waren denn das orginal und später das deutsche Lektorat?
Abschätzig und missbilligend hat der Autor seine Protagonistin gemacht, eine Frau, die aus unerfindlichen Gründen über jeden schlecht denkt. Die sich mit wildfremden Leuten anlegt, an Tankstellen, in Restaurants, in Supermärkten, die über jeden herzieht und ein Urteil fällt.
„Robert war garantiert ein schlechter Mann. Irgendwas an ihm, alles an ihm, war unsympathisch, unglaubwürdig, lüstern und frivol. Sein Hemd stand offen bis zu der Falte, wo die Trichterbrust auf den prallen Bauch traf.“
Ja, ja, die Intelligenzler rufen jetzt: Das muss so sein, das ist wichtig, der Autor repräsentiert dadurch die weiße amerikanische Mittelschicht. Dass Josie voller Vorurteile ist und nicht über den Tellerrand schauen kann, ist gesellschaftskritisch. Nun, wenn ihr meint, Aaber: Das macht das Buch auch nicht besser. Lückenhaft, unrealistisch, verkitscht, viel zu banal und letzten Endes ohne einen einzigen klugen Gedanken: Bis an die Grenze geht an die Grenze dessen, was ein Leser ertragen kann.
Bis an die Grenze von Dave Eggers ist erschienen bei Kiepenheuer & Witsch (ISBN 978-3-462-04946-6, 496 Seiten, 23 Euro).
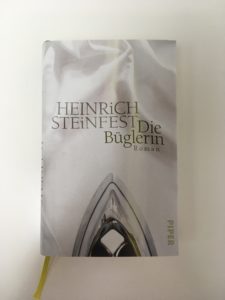 Ich weiß nicht so genau, was mit Heinrich Steinfest los ist, und ich frage mich das schon länger. Seine Bücher sind derart merkwürdig, man kann sie keiner Kategorie zuordnen. Früher hab ich alte Krimis von ihm gelesen, dann Das grüne Rollo, und das war schon recht gewöhnungsbedürftig, aber mit Die Büglerin schießt er endgültig den Vogel ab. Während der Lektüre hab ich ungefähr alle Emotionen durchlebt, die man so haben kann bei einem Buch: Ich war begeistert, angerührt, ich hab mich geärgert, ich war genervt. Alles nacheinander, alles gleichzeitig. Da gibt es Sätze, die mochte ich sehr, da gibt es Sprachbilder, die bewundere ich. Fein erzählt, mit einer sehr eigenen Sprachmelodie, wirklich wunderbar. Der Inhalt allerdings gibt Rätsel auf: Tonia Schreiber verschenkt ihr gesamtes Vermögen und wird Büglerin, weil sie sich selbst bestrafen möchte für die Rolle, die sie beim Tod ihrer Nichte gespielt hat. Dieser Tod ist hochgradig seltsam, Tonia selbst ist es auch, die gesamte Story ebenfalls, eigentlich passt nichts zusammen, alles ist einfach nur abstrus und unglaubwürdig. Einerseits reizt mich das Kuriose, weil es anders ist und originell – und weil mich doch der übliche Einheitsbrei ohnehin so schrecklich fadisiert –, andererseits denke ich zu oft: Also, Heinrich, im Ernst jetzt? Was erzählst du mir da für einen Blödsinn? Und es scheint kaum möglich zu sein, doch es gelingt ihm, das bis zum Ende noch zu steigern, der Schluss ist der Gipfel des Absurden. Ein Buch, über das man euphemistisch sagen könnte: Es ist … interessant.
Ich weiß nicht so genau, was mit Heinrich Steinfest los ist, und ich frage mich das schon länger. Seine Bücher sind derart merkwürdig, man kann sie keiner Kategorie zuordnen. Früher hab ich alte Krimis von ihm gelesen, dann Das grüne Rollo, und das war schon recht gewöhnungsbedürftig, aber mit Die Büglerin schießt er endgültig den Vogel ab. Während der Lektüre hab ich ungefähr alle Emotionen durchlebt, die man so haben kann bei einem Buch: Ich war begeistert, angerührt, ich hab mich geärgert, ich war genervt. Alles nacheinander, alles gleichzeitig. Da gibt es Sätze, die mochte ich sehr, da gibt es Sprachbilder, die bewundere ich. Fein erzählt, mit einer sehr eigenen Sprachmelodie, wirklich wunderbar. Der Inhalt allerdings gibt Rätsel auf: Tonia Schreiber verschenkt ihr gesamtes Vermögen und wird Büglerin, weil sie sich selbst bestrafen möchte für die Rolle, die sie beim Tod ihrer Nichte gespielt hat. Dieser Tod ist hochgradig seltsam, Tonia selbst ist es auch, die gesamte Story ebenfalls, eigentlich passt nichts zusammen, alles ist einfach nur abstrus und unglaubwürdig. Einerseits reizt mich das Kuriose, weil es anders ist und originell – und weil mich doch der übliche Einheitsbrei ohnehin so schrecklich fadisiert –, andererseits denke ich zu oft: Also, Heinrich, im Ernst jetzt? Was erzählst du mir da für einen Blödsinn? Und es scheint kaum möglich zu sein, doch es gelingt ihm, das bis zum Ende noch zu steigern, der Schluss ist der Gipfel des Absurden. Ein Buch, über das man euphemistisch sagen könnte: Es ist … interessant. Nadia und Saeed müssen fliehen aus dem Land, in dem sie zuhause sind, weil es auf einen Bürgerkrieg zusteuert, weil es nicht mehr sicher ist. Sie sind verliebt, vielleicht, oder zumindest empfinden sie Zuneigung füreinander, so genau weiß man das nicht beziehungsweise kann man sich da schon mal irren, wenn man sich ständig in Gefahr befindet und einem das Adrenalin durchs Blut schießt. So weit, so gut, die beiden machen sich also auf den Weg in eine andere Welt, in der es ihnen hoffentlich besser geht, und: Ein Buch über Flucht zu schreiben in einer Zeit wie dieser, sollte das nicht eigentlich eine sichere Bank sein? Also hab ich gedacht, Mohsin Hamid, der kann das bestimmt, wenn der sich schon so ein Thema vornimmt, dann hat er dazu auch was zu sagen, dann lässt er all die Emotionen hochkochen, die mit Migration und Heimatlosigkeit verbunden sind. Dann zeigt er, wie es wirklich ist. Stattdessen hat der liebe Mohsin mich schwer enttäuscht, weil er es eben nicht sagt und eben nicht zeigt: Nadia und Saeed fliehen durch eine Tür. Einfach so, sie gehen durch Türen und kommen woanders heraus, das ist alles, daraus besteht ihre Flucht, und ich finde das, Entschuldigung, ein bisschen schwammig, ein bisschen feig, denn wenn man schon die Chance hat, gehört zu werden, sollte man das nicht verharmlosen, nicht so tun, als sei es leicht, ein Durchschlüpfen bloß, haha, eine Tür, nichts sonst, unglaublich eigentlich, dass Menschen dabei sterben. Was ist das, Mohsin, ein Märchen, eine Verarschung, ein Witz? Lest dieses Buch nicht, lest lieber ein gutes, eines, das die Sorgen und Nöte, die Angst und den Kummer von Menschen auf der Flucht ernst nimmt.
Nadia und Saeed müssen fliehen aus dem Land, in dem sie zuhause sind, weil es auf einen Bürgerkrieg zusteuert, weil es nicht mehr sicher ist. Sie sind verliebt, vielleicht, oder zumindest empfinden sie Zuneigung füreinander, so genau weiß man das nicht beziehungsweise kann man sich da schon mal irren, wenn man sich ständig in Gefahr befindet und einem das Adrenalin durchs Blut schießt. So weit, so gut, die beiden machen sich also auf den Weg in eine andere Welt, in der es ihnen hoffentlich besser geht, und: Ein Buch über Flucht zu schreiben in einer Zeit wie dieser, sollte das nicht eigentlich eine sichere Bank sein? Also hab ich gedacht, Mohsin Hamid, der kann das bestimmt, wenn der sich schon so ein Thema vornimmt, dann hat er dazu auch was zu sagen, dann lässt er all die Emotionen hochkochen, die mit Migration und Heimatlosigkeit verbunden sind. Dann zeigt er, wie es wirklich ist. Stattdessen hat der liebe Mohsin mich schwer enttäuscht, weil er es eben nicht sagt und eben nicht zeigt: Nadia und Saeed fliehen durch eine Tür. Einfach so, sie gehen durch Türen und kommen woanders heraus, das ist alles, daraus besteht ihre Flucht, und ich finde das, Entschuldigung, ein bisschen schwammig, ein bisschen feig, denn wenn man schon die Chance hat, gehört zu werden, sollte man das nicht verharmlosen, nicht so tun, als sei es leicht, ein Durchschlüpfen bloß, haha, eine Tür, nichts sonst, unglaublich eigentlich, dass Menschen dabei sterben. Was ist das, Mohsin, ein Märchen, eine Verarschung, ein Witz? Lest dieses Buch nicht, lest lieber ein gutes, eines, das die Sorgen und Nöte, die Angst und den Kummer von Menschen auf der Flucht ernst nimmt. „Wir sind kurz vor dem Verfallsdatum, und deshalb wird jetzt noch einmal richtig gefeiert“
„Wir sind kurz vor dem Verfallsdatum, und deshalb wird jetzt noch einmal richtig gefeiert“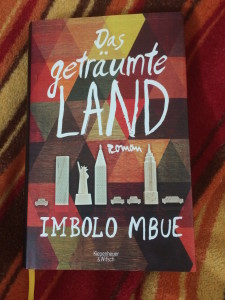 „Mein Körper ist hier, aber mein Herz ist nachhause zurückgereist“
„Mein Körper ist hier, aber mein Herz ist nachhause zurückgereist“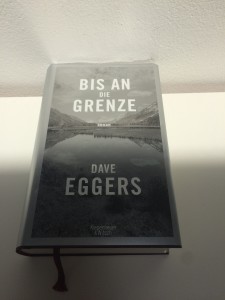 „Manchmal fordert ein Ort dich auf, zu bleiben, nirgendwohin zu hasten“
„Manchmal fordert ein Ort dich auf, zu bleiben, nirgendwohin zu hasten“ „Mein Schweigen hielt mich im Reich des Unsichtbaren“
„Mein Schweigen hielt mich im Reich des Unsichtbaren“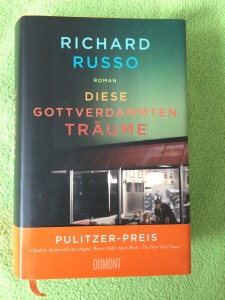 „Ich bin vielleicht alt, aber ein Arschloch erkenne ich, wenn ich einem begegne“
„Ich bin vielleicht alt, aber ein Arschloch erkenne ich, wenn ich einem begegne“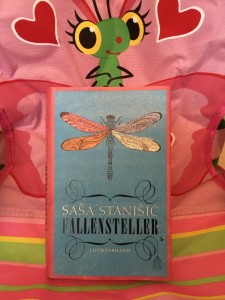 „Es geht in Unterhaltungen nicht unbedingt darum, einander zu verstehen, sondern es miteinander auszuhalten“
„Es geht in Unterhaltungen nicht unbedingt darum, einander zu verstehen, sondern es miteinander auszuhalten“ Verrückt, verrückter, Luiselli
Verrückt, verrückter, Luiselli „Nie spürt man die eigene Macht so sehr wie in jenen Momenten, in denen man sie missbraucht“
„Nie spürt man die eigene Macht so sehr wie in jenen Momenten, in denen man sie missbraucht“