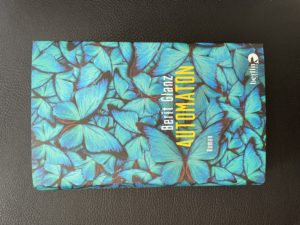 „Irgendwann wird es immer wieder besser“
„Irgendwann wird es immer wieder besser“
Tiff arbeitet als Klickworkerin für die Plattform Automa, weil sie einerseits ein kleines Kind und andererseits eine Angststörung hat, die sie daran hindert, die Wohnung zu verlassen. Deshalb kommt es ihr entgegen, dass sie sich nachts, wenn das Kind schläft, für verschiedene Jobs einloggen kann – die jedoch schlecht bezahlt und zermürbend sind. In der Chatfunktion der Plattform unterhält sie sich mit ihren Freunden, die auf der Welt verstreut leben und zu unterschiedlichen Zeiten wach sind. Was sie eint, ist nicht nur die prekäre Lebenssituation, sondern auch eine Art virtueller Zusammenhalt. Als sie auf den Videos einer Sicherheitskamera etwas beobachten, das sie nicht mehr loslässt, versuchen sie herauszufinden, was passiert ist.
„Dieses Buch ist ein Geniestreich“, habe ich geschrieben, als ich Berits Manuskript vorab lesen durfte, „vordergründig geht es um Kapitalismus, Digitalisierung und Angst, aber im Kern enthält es, was dabei oft vergessen wird: unsere Menschlichkeit.“ Jetzt muss ich erst einmal sagen, dass ich Berit Glanz schon lange bewundere, sie hat mich nämlich bereits mit ihrem Roman „Pixeltänzer“ (den ich euch sehr empfehlen kann!) überzeugt – und tut es jeden Sonntag mit ihrem Newsletter, mit dem sie mir erklärt, was ich die ganze Woche im Internet erlebt habe. Sie ist unglaublich schlau, hat ein beeindruckendes Spezialwissen zu Memes, Internetphänomenen und skandinavischen Sprachen und kann noch dazu ausgezeichnet schreiben. Mit ihrem neuen Roman hat sie mich überrascht: Die ganze Zeit habe ich gedacht, das wird böse enden, habe vor mir gesehen, in welche Richtung es gehen wird. Aber Berit hat einen anderen Weg eingeschlagen, und das rechne ich ihr hoch an. Ich finde es mutig von ihr, die Geschichte auf diese Weise zu Ende zu bringen, und ich hoffe, dass ihr alle diesen Roman lesen werdet. Weil er sich mit der Situation alleinerziehender Mütter auseinandersetzt, weil er neue Berufsgruppen durchleuchtet und weil er etwas hat, das uns allen fehlt: einen Hoffnungsschimmer. Großartiges Buch mit einem der schönsten Cover aller Zeiten!
Automaton von Berit Glanz ist erschienen im Berlin Verlag.
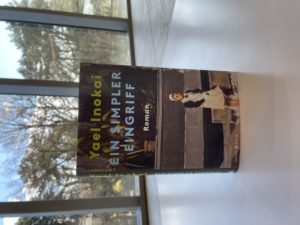 „Und mir wurde klar, was ein Bett tragen muss, Knochen und Fleisch und Blut und alles, was ein Mensch gesehen hat“
„Und mir wurde klar, was ein Bett tragen muss, Knochen und Fleisch und Blut und alles, was ein Mensch gesehen hat“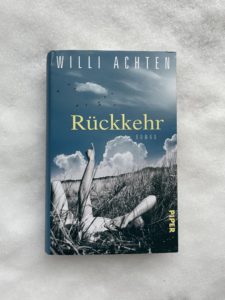 „Da ist ein Puls in mir, der mich zurückbrachte an diesen Ort“
„Da ist ein Puls in mir, der mich zurückbrachte an diesen Ort“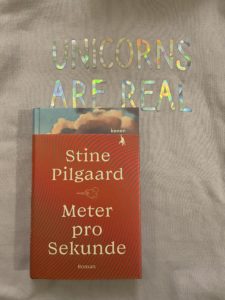 „Kein Mensch will wissen, wie es dir geht, vergiss das nicht“
„Kein Mensch will wissen, wie es dir geht, vergiss das nicht“ „Da ist eine Leere. Die ist schon seit einer ganzen Weile da, auch als sein Vater noch lebte“
„Da ist eine Leere. Die ist schon seit einer ganzen Weile da, auch als sein Vater noch lebte“ „Sie entfernen mich immer weiter von etwas, das ich mir einmal unter Professionalität vorgestellt habe“
„Sie entfernen mich immer weiter von etwas, das ich mir einmal unter Professionalität vorgestellt habe“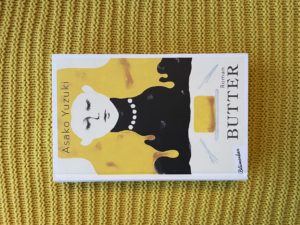 „Ideal für den Heiratsmarkt sind Frauen mit geringer Vitalität. Solche, die eher tot als lebendig sind“
„Ideal für den Heiratsmarkt sind Frauen mit geringer Vitalität. Solche, die eher tot als lebendig sind“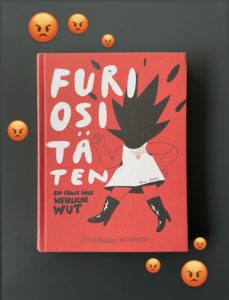 Ich lese selten bis nie Comics, aber einen über weibliche Wut? Den musste ich natürlich haben. Und was soll ich sagen: Wow. Wie Anna Geselle zeichnet und schreibt, aufbereitet und informiert, ist sensationell. Es geht um Historisches und Philosophisches, um Traditionelles und Heutiges. Wann hat das angefangen, dass die Wut der Frauen kleingehalten wurde – und warum? Wer profitiert davon und wieso? Was haben Seneca und Freud damit zu tun? Wer war Guillaume Benjamin Duchenne de Bologne und was ist eine Ovarienpresse? Kurz und knackig wird erklärt, worauf die Verbannung der weiblichen Wut fußt, und ich muss sagen, das in Comic-Form zu lesen, ist richtig gut. Erzählt wird zum Beispiel, wie grausam die Behandlung war, mit denen man Frauen ihre „Hysterie“ aberziehen wollte, wie sich Fruchtfliegen, Hyänen und Mäuse verhalten und was es mit She-Hulk auf sich hat, erschienen im Jahr 1980.
Ich lese selten bis nie Comics, aber einen über weibliche Wut? Den musste ich natürlich haben. Und was soll ich sagen: Wow. Wie Anna Geselle zeichnet und schreibt, aufbereitet und informiert, ist sensationell. Es geht um Historisches und Philosophisches, um Traditionelles und Heutiges. Wann hat das angefangen, dass die Wut der Frauen kleingehalten wurde – und warum? Wer profitiert davon und wieso? Was haben Seneca und Freud damit zu tun? Wer war Guillaume Benjamin Duchenne de Bologne und was ist eine Ovarienpresse? Kurz und knackig wird erklärt, worauf die Verbannung der weiblichen Wut fußt, und ich muss sagen, das in Comic-Form zu lesen, ist richtig gut. Erzählt wird zum Beispiel, wie grausam die Behandlung war, mit denen man Frauen ihre „Hysterie“ aberziehen wollte, wie sich Fruchtfliegen, Hyänen und Mäuse verhalten und was es mit She-Hulk auf sich hat, erschienen im Jahr 1980.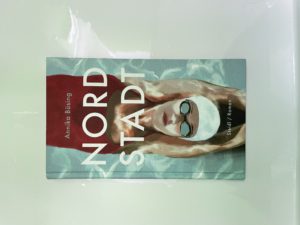 „Für die Liebe musst du auch ins Wasser steigen, obwohl du müde bist“
„Für die Liebe musst du auch ins Wasser steigen, obwohl du müde bist“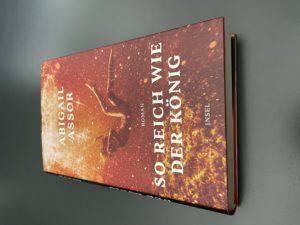 „Sie verfügte über eine neue Macht, wo doch ihr ganzes Wesen – als Frau, als Arme – sie von jeher zur Unterdrückung verurteilt hatte“
„Sie verfügte über eine neue Macht, wo doch ihr ganzes Wesen – als Frau, als Arme – sie von jeher zur Unterdrückung verurteilt hatte“