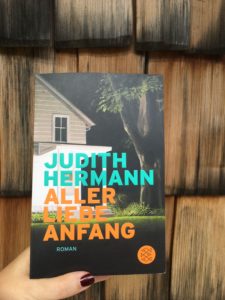 „Die Reue macht die Dinge schwer, gleichzeitig einzigartig“
„Die Reue macht die Dinge schwer, gleichzeitig einzigartig“
Stella hadert mit ihrem Leben, nicht viel, nur ein bisschen, gerade genug, dass das große Glück außer Reichweite scheint. Jason hat sie im Flugzeug kennengelernt, er hat ihre Hand gehalten und nun sind sie zusammen, sie haben ein nettes Haus, die gemeinsame Tochter Ava ist süß. Stella arbeitet als Altenpflegerin und ist nicht zufriedener oder unzufriedener als andere. Jason ist oft beruflich unterwegs, und dann haben die beiden Mädels ihre Routine. Die jäh unterbrochen wird: Vor der Tür steht ein Mann mit dem unglaublich dämlichen Namen Mister Pfister. Er wolle mit Stella reden, sagt er, und sie verweigert es ihm. Von da an kommt er jeden Tag, klingelt, legt einen Brief oder eine Karte in den Postkasten und geht wieder. Es bedeutet vielleicht nichts und ist dennoch beunruhigend, es wirft Stella aus der Bahn. Sie erzählt Jason davon, der typisch männlich-aggressiv reagiert. Es beginnt mit einem Finger auf einem Klingelknopf – und es eskaliert.
Judith Hermann ist bekannt für ihre klare, kräftige Sprache, die leise und vorsichtig daherkommt und dabei langsam Fahrt aufnimmt. In diesem schmalen Band sammelt sie Holz für ein Feuer, sammelt Worte für ein fulminantes Ende, sammelt Gefühle für ein Überkochen. Die Erzählung ist seltsam verstörend, nicht spannend, nicht thrillermäßig, sie hat keinen Drive und keine Krimi-Elemente, aber man folgt ihr trotzdem aufgeregt und nervös. Es ist klar: Da wird etwas geschehen. Da ist etwas nicht in der Norm, und das kann nicht gutgehen. Nicht alles, was die Protagonisten tun und empfinden, ist für mich nachvollziehbar, und irgendwie wirkt das Buch auf mich wie eine Studie: Wenn ich einen Mann erfinde, der täglich zum Haus einer Frau geht und ihr eine Botschaft hinterlässt, wann knallt es – und in welcher Form? Als wären Mister Pfisters Briefe die Tropfen der chinesischen Wasserfolter. Und Stella, ja, die ist doch sowieso nicht ganz zurechnungsfähig, die ist doch eh nicht im Gleichgewicht, das war sie nie, bisschen frustrierte Hausfrau, bisschen unglückliche Mutter – die perfekte Kombination, um eine kleine Vorstadtbombe zu zünden. Missverständlich ist allein der Titel: Eine Liebe ist das letzte, was hier anfängt.
Aller Liebe Anfang von Judith Hermann ist als Taschenbuch erschienen bei S. Fischer (ISBN 978-3-596-19641-8, 224 Seiten, 9,99 Euro).
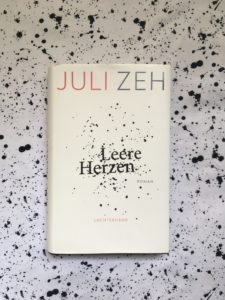 „Um zu hassen, müsste man erst mal wissen, worauf es ankommt“
„Um zu hassen, müsste man erst mal wissen, worauf es ankommt“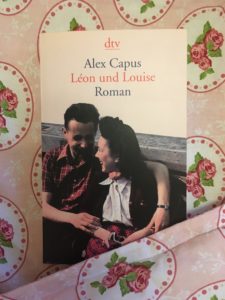 Eine Liebe durch die Jahrzehnte
Eine Liebe durch die Jahrzehnte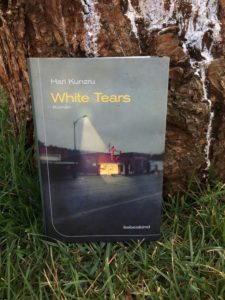 „Wenn das Grauen an dich glaubt, kannst du nichts dagegen tun“
„Wenn das Grauen an dich glaubt, kannst du nichts dagegen tun“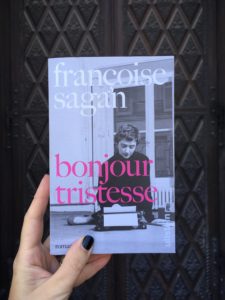 „Diese Auffassung hatte etwas Verführerisches für mich: schnell lieben, heftig und flüchtig. Ich war nicht in dem Alter, dem Treue etwas bedeutet. Rendezvous, Küsse, schließlich der Überdruss, das war alles, was ich von der Liebe wusste“
„Diese Auffassung hatte etwas Verführerisches für mich: schnell lieben, heftig und flüchtig. Ich war nicht in dem Alter, dem Treue etwas bedeutet. Rendezvous, Küsse, schließlich der Überdruss, das war alles, was ich von der Liebe wusste“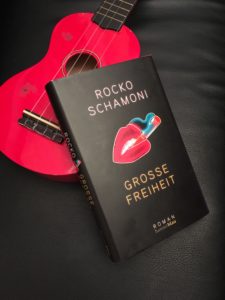 „St. Pauli ist eine riesige Melkmaschine!“
„St. Pauli ist eine riesige Melkmaschine!“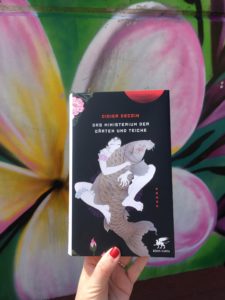 „Zwischen morgens und abends kann jemandem, den man liebt, so viel passieren“
„Zwischen morgens und abends kann jemandem, den man liebt, so viel passieren“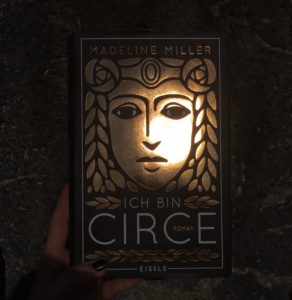 „Unter der glatten Oberfläche des Vertrauten wartet etwas anderes darauf, die Welt in Stücke zu reißen“
„Unter der glatten Oberfläche des Vertrauten wartet etwas anderes darauf, die Welt in Stücke zu reißen“ Bei
Bei 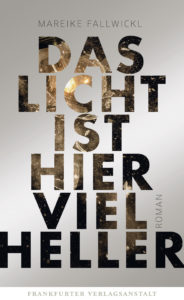 Es ist „nur“ ein Buch, ich weiß das. Aber wenn es diesem Buch gelingt, bei einer Handvoll Lesern etwas zu bewirken, ein Nachdenken, ein Umdenken, ein Wütendwerden, ein So-nicht-mehr-Gefühl, dann ist das schon viel. Dann ist das alles, was ich mir wünsche. Erwartet also bitte keine Wohlfühlkuschellesezeit. Erwartet Zynismus und Biss und Witz und Traurigkeit und Bitterkeit. Ich weiß nicht, was diesem Roman und mir blüht und ob man unsanft mit uns umgehen wird, aber ich weiß: Es ist gut, dass ich ihn geschrieben habe. Weil Schluss sein muss damit, dass über diese Dinge geschwiegen wird.
Es ist „nur“ ein Buch, ich weiß das. Aber wenn es diesem Buch gelingt, bei einer Handvoll Lesern etwas zu bewirken, ein Nachdenken, ein Umdenken, ein Wütendwerden, ein So-nicht-mehr-Gefühl, dann ist das schon viel. Dann ist das alles, was ich mir wünsche. Erwartet also bitte keine Wohlfühlkuschellesezeit. Erwartet Zynismus und Biss und Witz und Traurigkeit und Bitterkeit. Ich weiß nicht, was diesem Roman und mir blüht und ob man unsanft mit uns umgehen wird, aber ich weiß: Es ist gut, dass ich ihn geschrieben habe. Weil Schluss sein muss damit, dass über diese Dinge geschwiegen wird.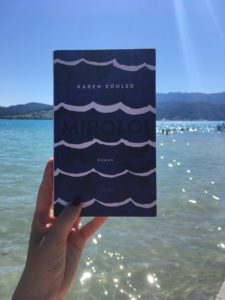 „Unser Dorf hat tausend Augen, die sehen alles, alles, alles“
„Unser Dorf hat tausend Augen, die sehen alles, alles, alles“