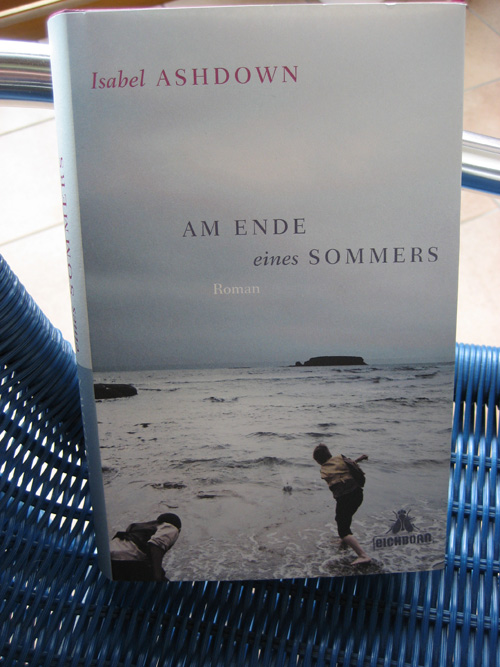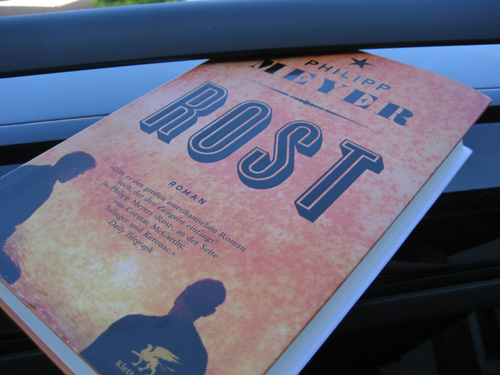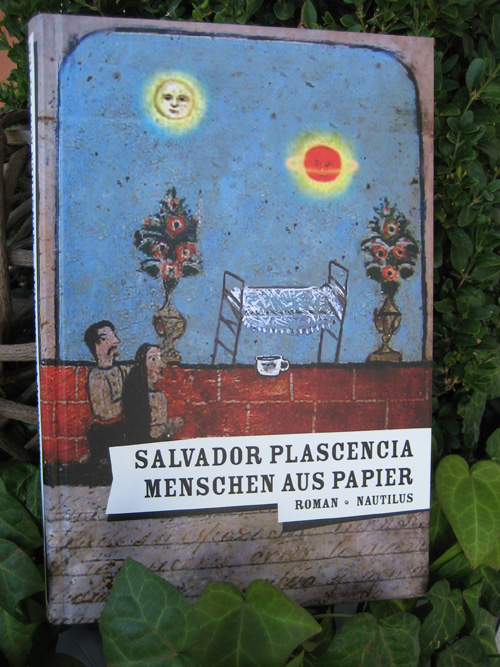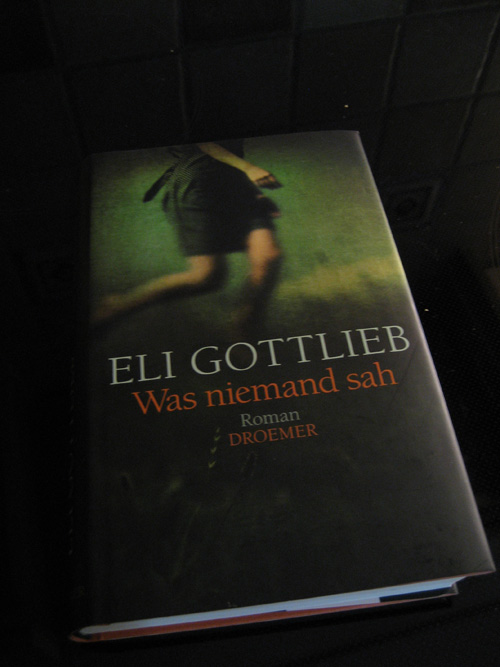Genie oder Wahnsinn?
Genie oder Wahnsinn?
Sam Leiser war drei Jahre alt, als er mit seinem Vater Yehuda und dem geheimnisvollen Meyer vor dem Holocaust nach Amerika flüchtete. Dort wurde aus Yehuda der berühmte Autor Jonathan Still, “Erfinder einer der bekanntesten Detektivgestalten der Neuzeit”. Jahre später lebt Sam in Paris und übersetzt des Vaters Werke ins Deutsche, stets auf der Suche nach geheimen Botschaften, die nur er deuten könnte. Getrennt von seiner großen Liebe Letitia, verliebt er sich in seine Spanischlehrerin Elizabeth und bekommt Besuch von seiner 12-jährigen, pubertierenden und den Aufstand probenden Tochter Ashy, die für ein Jahr bei ihm bleiben und den Schritt ins Erwachsenenleben schaffen soll. Die zahlreichen düsteren Gestalten, die die Türschwelle von Sam heimsuchen, und sein egozentrischer Charakter sind bei diesem Vorhaben aber nicht unbedingt hilfreich.
Der Vogel, der spazieren ging ist eine Mischung aus moderner Fiktion und “film noir” zum Lesen. Zwar fehlt das zentrale Motiv dieses Filmgenres – ein Mord – , doch die teilweise kriminellen Machenschaften der Romanfiguren sind davon nicht weit entfernt. Wer wem an den Kragen will und warum eigentlich – das ist eine Frage, die bis zum Schluss ungeklärt bleibt. Die Atmosphäre erinnert stark an jene alten Detektivgeschichten, die Sams Vater schrieb – vermutlich eine bewusste Anlehnung an diese Sparte. Allerdings fehlt es an einer klaren Struktur, Figuren kommen und gehen, verfolgen jemanden, brechen ein und stehlen, verlieben sich, sterben. Elizabeths Vater spielt eine merkwürdige Schlüsselrolle, und als Yehuda mit der Gangsterverwandtschaft in Paris eintrifft, gerät die Lage – und die Handlung im Roman – vollständig außer Kontrolle. Es ist ein wirrer Reigen an Gestalten, die Martin Kluger auftreten lässt, die Hintergründe sind überraschend dunkel, obwohl eigentlich kaum etwas Verachtenswertes passiert. Ein großes Ganzes kann ich inhaltlich nicht erkennen, ich folge den einzelnen plastischen Szenen wie in einem klassischen Schwarz-Weiß-Film, bei dem man schon ganz genau aufpassen muss, um den Faden nicht zu verlieren.
Gut gelungen sind die Einschübe jüdischer Kultur und jüdischen Humors, besonders für Tochter Ashy sind die Wurzeln der Familie von Bedeutung. Grundsätzlich aber kommt die Komik, von der andere Rezensenten schwärmen, nicht bei mir an. Stilistisch gesehen ist Der Vogel, der spazieren ging ein undurchgängiger Mix aus klaren, schönen Formulierungen wie “Lebst du allein, ist die Küche der einsamste Ort der Welt” und überstrapazierten, komplizierten Sätzen, die dem Leser schnell die Geduld rauben, ein Beispiel: “Ihr edles Ringen mit Gott, ihre Sehnsucht nach Innigkeit und Hingabe, das frühe Sich-Versenken in den Quijote, der das Reich Gestalten-mischender Möglichkeit viel ungetrübter aufmischte als Goethe: alles profanisiert von einem gescheiterten Chauvinisten mit violetten Augen, der sich einbildete, ihr leiblicher Vater zu sein und, wenn mich nicht alles täuschte, scharf auf sie war.” Ich kann mich daher lange nicht entscheiden, ob ich dieses Buch nun mag oder nicht, ich schwanke von Seite zu Seite und hoffe auf einen Knalleffekt am Ende, auf des Rätsels Lösung, auf ein zufriedenes Nicken meinerseits – das aber leider ausgeblieben ist.
Der Vogel, der spazieren ging ist erschienen bei Dumont (ISBN 978-3-8321-7998-4, 19,90 Euro).