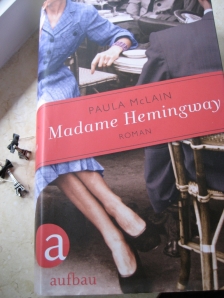“Draußen ist mehr Platz zwischen den Menschen”
“Draußen ist mehr Platz zwischen den Menschen”
Zwei Jahre lang hat der 18-jährige Taguchi sein Zimmer im Haus seiner Eltern kaum verlassen, hat sich der Welt komplett entzogen: “Mein Dasein bestand darin, dass ich fehlte. Ich war das Sitzkissen, auf dem keiner saß, der Platz am Tisch, der leer blieb, die angebissene Pflaume auf dem Teller, den ich zurück vor die Tür gestellt hatte. Indem ich fehlte, hatte ich gegen das Gesetz verstoßen, das besagt, dass man da sein und wenn man da ist, dass man etwas tun, etwas erreichen muss.” Zwei Jahre lang hat Taguchi sich totgestellt, und als er nach dieser Zeitspanne merkt, dass er immer noch lebt, geht er nach draußen. Er wagt sich in den Park, setzt sich auf eine Bank und kehrt von nun an jeden Tag zu ihr zurück. Er hat Angst vor den Menschen, denn: “Jemandem zu begegnen bedeutet, sich zu verwickeln.” Genau das passiert ihm, als er im Park den über 50-jährigen Salaryman Teshi kennenlernt, er verwickelt sich in dessen Geschichte und entwirrt seine eigene. Teshi sitzt wie Taguchi von morgens bis abends im Park, beide sind sie aus dem Alltagstrott gefallen, der die Menschen schraubzwingenartig festhält, wurden hinausgeworfen oder haben sich ihm verweigert. Und kaum haben die beiden Einsamen sich als Gleichgesinnte gefunden, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als einander das Herz auszuschütten – sie haben sonst niemanden. Teshi wurde entlassen und schafft es nicht, seiner Frau davon zu erzählen, hält die Routinelüge des täglichen morgendlichen Abschieds aufrecht, obwohl er glaubt, dass sie es längst weiß. Aber es gibt noch mehr, das er ihr nicht sagen kann, vor allem in Bezug auf den tragischen Verlust, den die beiden einst erlitten haben. Was es bedeutet, jemanden zu verlieren, weiß auch Taguchi trotz seines jungen Alters bereits, und an manchem Verlust war er nicht ganz unschuldig. Er hat viel zu bereuen und trägt schwer an der Schuld von einem, der immer nur wegschaut, der so viel wegschaut, dass er plötzlich das Haus nicht mehr verlassen kann, weil er dann etwas sehen würde. Sie sind zwei Fremde, die auf einer Parkbank sitzen, und sie könnten einander näher nicht sein. Zwei traurige Gestalten, allein inmitten von Millionen Menschen, auf sich geworfen in dem Moment, in dem sie sich eingestanden: Ich kann nicht mehr.
Milena Michiko Flašar, österreichische Schriftstellerin mit japanischen Wurzeln, hat ein Buch geschrieben, das so zärtlich ist wie ein liebevoll-flüchtiger Kuss auf die Stirn, so klug wie der Blick eines Großvaters, der wissend lächelt und großzügig schweigt. Zwei Menschen treffen aufeinander in einem Park, wie es viele gibt, zwei Menschen, die umgeben sind von je einer Blase, um alle anderen abzuhalten, um sich vor der Welt zu schützen. Sie setzen sich nebeneinander, und aus den zwei Blasen wird eine einzige, in der sie sich zu zweit verstecken. Für 139 Seiten darf ich neben ihnen sitzen und den vielen Stimmen lauschen, die um sie herumschwirren: der Stimme eines Mädchens, das aus dem Fenster springt, der Stimme eines jugendlichen Dichters, der vor ein Auto läuft, der allerleisesten Stimme eines Babys, das nie geweint hat. Ich sitze neben den beiden Verlorenen und sehe zu, wie die Geschichten aus ihnen hinausfließen, und hätte ich länger zusehen können, wären sie vielleicht eines Tages leer gewesen wie Gefäße, in denen Platz ist für Buntes und Neues. In einer sehr melodischen, durchdringend klaren, spartanisch schlichten Sprache zeichnet Milena Michiko Flašar ein Bild der heutigen japanischen Gesellschaft, in der Angestellte sich sprichwörtlich zu Tode schuften und beim ersten Fehler vor dem Nichts stehen, im Alter abgeschoben werden und alles, absolut alles tun, um das Gesicht zu wahren. Die Jungen dagegen zwingt die Angst vor dem Leben in die Knie, sie halten dem Druck nicht stand und schließen sich selbst weg, Hikikomori werden sie genannt, und wie viele es von ihnen gibt, weiß man nicht, weil sie als Familienschande gelten. Die Worte, mit denen die Autorin das Leben dieser zwei Menschen zeichnet, die so unterschiedlich sind und einander in ihrer Verzweiflung doch gleichen, sind pure Poesie, so einfach wie schön. Sie verliert sich nicht in aufgeregten Spielereien, sinnlosen Verschnörkelungen und wirbelartigen, endlosen Satzkonstruktionen. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihre Sprache nicht kraftvoll wäre, im Gegenteil, leise ist sie, ein Wispern manchmal nur, und doch schmerzhaft wie ein Faustschlag. Milena Michiko Flašar schreibt über das zwischenmenschliche Beziehungsgeflecht, dem niemand sich entziehen kann, über das Schweigen, das die Stimmen nur umso lauter macht, über das Sich-die-Ohren-Zuhalten, wenn die Hilfeschreie anderer zu durchdringend sind, über Schuld, Lügen und Sich-vor-der-Welt-Verstecken – große Themen, an denen man scheitern könnte, die sie aber so elegant meistert wie eine alte französische Revuetänzerin den Can-Can. Ich nannte ihn Krawatte ist ein Buch, über das ich ganz rigoros sagen kann: Wen es nicht berührt, der hat kein Herz.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: wundervolle Farbkomposition, sehr edel, die Koi sind zutiefst japanisch.
… fürs Hirn: die Schuld der Mitläufer, wie groß ist sie? Der Druck der Gesellschaft auf den Einzelnen, wie groß ist er? Die Pflicht der Eltern, ihr Kind zu lieben, wie groß ist sie?
… fürs Herz: das Ende. Der Anfang. Und alles dazwischen.
… fürs Gedächtnis: meine liebste Szene, in der der Klavierlehrer über das Lachen spricht, über das Lachen für seine sterbende Frau, so ergreifend geschrieben, so wahr und klug, dass ich ihr mit Tränen Respekt zollen musste: “Wer in einem Lachen nichts anderes als ein Lachen hört, der ist taub.”
Ich nannte ihn Krawatte von Milena Michiko Flašar ist erschienen im Verlag Klaus Wagenbach (ISBN 978-3-8031-3241-3, 144 Seiten, 16,90 Euro).