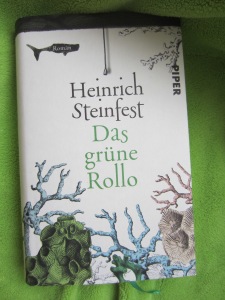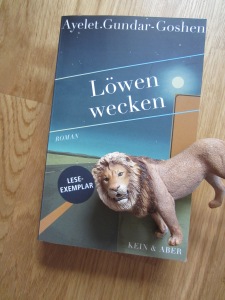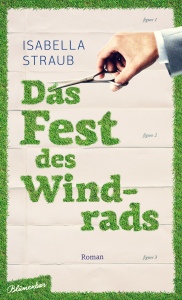Die hohe Kunst des Scheiterns
Die hohe Kunst des Scheiterns
„Man ist am Land anders befreundet als in der Stadt. Vor allem aber ist man anders verfeindet, konkreter, ernsthafter, konsequenter, körperlicher.“ Das bekommt Marian am eigenen Leib zu spüren, als sie in der kleine Häuschen am Waldrand zieht, das einst ihrer Tante gehörte. Marian, die eigentlich Marianne heißt, tut dies nicht aus nostalgischen Gründen, sie will nicht auf dem Land leben und kann es auch nicht, im ersten Winter geht sie fast ein, weil sie kein Essen und kein Holz hat, nur Schnaps. Sie muss aber, weil ihr nichts geblieben ist vom Luxusleben in Wien: Marian war Modedesignerin, erfolgreich, wohlhabend, mit einem Architektenfreund, einer Designerwohnung, unfassbar teuren Schuhen, tonnenweise Anti-Falten-Cremes und einer trendigen Laktoseintoleranz. Dann kamen falsche Anlagestrategien, falsche Investitionen und ein falscher Mann, Marian ist aus dem Federbett auf den nackten Asphalt gefallen, und deshalb bedeutet es ihr jetzt Luxus, dass sie gelernt hat, Brot zu backen. Und dass Großgrundbesitzer Franz ihr regelmäßig Mehl, Shampoo und Holz bringt. Das tut er freilich nicht umsonst, denn seit er Marian beim Wildern erwischt hat, bedient er sich an ihrem Körper. Daher auch die Feindschaft zu den Nachbarn und das „Hur“ auf Marians Tür. Aber die Frau, die früher in Seide schlief, hat einen eisernen Überlebenswillen bewiesen – und hat nicht vor, aufzugeben.
Die österreichische Autorin Doris Knecht hat mich mit ihrem bösen Roman Besser über die Maßen begeistert – so sehr, dass ich meine Nur-ein-Buch-pro-Autor-Regel gebrochen und ihr neuestes Werk gelesen habe. Zum Glück! Denn sie beweist auch darin eine messerscharfe Beobachtungsgabe und das Talent, menschliche Abgründe offenzulegen – mit einem herrlich ironischen Unterton. Ihre Protagonistin Marian ist sozusagen beim Leben selbst in Ungnade gefallen, sie hat zu hoch gepokert, war zu blind und zu leichtgläubig, hat jeglichen materiellen Besitz verloren. Doris Knecht hat dieser Frau alles genommen, hat ihr den Satin ausgezogen, die Manolos auch, hat ihr das Sushi vom Tisch gefegt und ihre Putzfrau entlassen, ihr Atelier zugesperrt und die Konten geleert, hat ihre Freundschaften enden lassen und ihr die Liebe genommen. Da ist nur noch dieses Haus irgendwo am Land, da sind die alten Strickjacken der Tante, ein paar Gartenbücher, ein Ofen, viel frische Luft. Kein Internet, keine Bars, keine Prominenten, kein Sojalatte. Wenn man so eine Prinzessin-auf-der-Erbse-Story liest, kann man schon ein bisschen schadenfroh sein. Marians eigene Schilderungen lassen das auch zu, weil sie auf sehr sarkastische Weise im Selbstmitleid badet, sich erinnert, alles bis ins kleinste Detail zerlegt, immer und immer wieder, um jenen Moment auszumachen, in dem ihr Schicksal zwischen Unkraut und Wollsocken besiegelt war.
Ich hätte gern, dass Doris Knecht im echten Leben meine Freundin wäre. Weil ich mir vorstelle, dass ich mit ihr so herrlich gemeine Lästergespräche führen könnte, nach denen wir uns den Mund mit Seife auswaschen müssten. Da Doris Knecht bestimmt schon genug Freundinnen hat – und ich zum Glück ja auch –, lese ich einfach ihre Bücher. Die erfreuen nämlich auch diesen kleinen Fiesling, der in mir wohnt. Denn Sarkasmus kann nur dann zünden, wenn er klug ist – genau wie in Wald. Doris Knecht ist so nah dran an der Wahrheit, dass sogar ich – die nicht das feine Leben einer Designerin führt – mich bei manchen Gedankengängen erkannt und ertappt fühle. Da darf jeder sich in der gescheiterten Anfangsvierzigerin erkennen und sich an die eigene Nase greifen. Außerdem liebe ich es, dass das Buch so österreichisch ist und sein darf, dass die Austriazismen nicht im Lektorat ausradiert wurden. Für mich macht dies den Roman noch authentischer, er trifft meinen Humor, meine Sprachwelt, meine Vorstellung vom puren Lesevergnügen zu 100 Prozent. Deshalb kann ich nur sagen: Schärft euren Intellekt mit Doris Knecht, durchleuchtet mit ihr eine Dorfgemeinschaft, in der jeder nur sich selbst der Nächste ist, überlegt euch, was ihr wirklich zum Leben braucht, und amüsiert euch nebenbei ganz prächtig.

Wald von Doris Knecht ist erschienen im Rowohlt Verlag (ISBN 978-3-87134-769-6, 272 Seiten, 19,95 Euro).
Noch mehr Futter:
– „Welchen Einfluss hat der Rückfall in nahezu primitive Lebensumstände auf das soziale Verhalten, auf Wertvorstellungen und Gefühle? Diese Überlegung hat sich Doris Knecht zum Ausgangspunkt ihres neuen Romans gemacht“, erläutert die wienerzeitung.
– „Knecht wiederholt Namen und Schlüsselworte, bis zu zwölf Mal auf einer Seite, so dass ein beschwörender Ton entsteht, ein unheimlicher Sound, der noch verstärkt wird durch die Verwendung herber Austriazismen. Wald liest sich wie eine 270 Seiten lange Gedankenschleife, ganz eigen, ganz eindringlich“, heißt es auf spiegel.de.
– „Da ist nix mit Idyll. Bei Doris Knecht gibt es kein nur gut oder nur schlecht, da haben alle Personen Risse, Unschärfen und Inkonsequenzen“, schreibt Sonja von lustzulesen.de.
– Auf standard.at könnt ihr ein Interview mit der Autorin lesen.
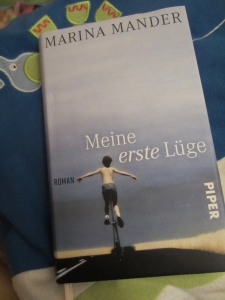 Das traurigste Buch
Das traurigste Buch