 Von den Phasen, in denen alle Bücher mich langweilen
Von den Phasen, in denen alle Bücher mich langweilen
Manchmal denke ich: Nie wieder werde ich ein gutes Buch finden. Eins, das mich fesselt, begeistert, berührt. Nie mehr, es ist vorbei. Jetzt sterbe ich am Overkill, das war’s. Denn: Es langweilt mich. Alles langweilt mich. Es gibt Zeiten, da nehme ich ein Buch nach dem anderen in die Hand, voller Hoffnung, voller Optimismus, doch die Seiten fliegen vorbei, und ich merke: Das wird nix mit uns. Ich gebe nicht gleich auf, ich wühle mich durch, warte auf den Moment, in dem es mich hineinzieht in die Story. Wenn der nicht kommt, finde ich plötzlich lauter andere wichtige Dinge, die ich tun muss, statt zu lesen, Wäsche aufhängen, Kinderbilder mit Datum beschriften, den Keller aufräumen. Daran merke ich, dass der Roman mich nicht interessiert. Ich habe gelernt, Bücher abzubrechen, keine Lebenszeit zu verschwinden, und ich tue das, aber ich leide darunter. Es fällt mir nicht leicht. Vor allem dann, wenn es so viele sind, und 2016 ist – auch – in dieser Hinsicht ein besonders schlechtes Jahr. Zum Teil hat sich ein mieses Buch an das andere gereiht, ich habe drei, vier, sechs, sieben, einmal sogar ELF hintereinander in die Ecke geworfen, aussortiert, verschenkt, durch manche hab ich mich gequält, nur um dann in Motztiraden auszubrechen. Viele haben mir durchaus gefallen, aber sie waren eben einfach nur okay, nicht schlecht, aber auch nicht überragend, Mittelmaß. Über diese Titel zu schreiben, ist am schwierigsten, weil ich dann nicht viel zu sagen habe außer: Kann man lesen, muss man aber nicht. Weil sie nichts in mir ausgelöst haben, weil ich sie schon bald wieder vergessen haben werde. Seit einer ganzen Weile schon weiß ich nicht, was ich als „Buch des Monats“ auswählen soll, weil ich ganz einfach keines habe, und nehme dann das, das am wenigsten schlecht war. Ich schreibe Mails an die Verlage und entschuldige mich, erkläre, dass ich das jeweilige Buch nicht lesen konnte, dass es nicht das richtige war für mich, dass es zu fad war, zu nichtssagend, und das schlechte Gewissen knabbert dann an mir, auch wenn die Reaktionen stets verständnisvoll und wohlwollend sind (und durchaus Rückmeldungen kommen, dass es dem zuständigen Pressemenschen ähnlich ging). Es gab in diesem Jahr schon viele solcher Mails. Und das beunruhigt mich zunehmend. Auffallend oft waren das Romane, die mit Lob überhäuft wurden und bei denen ich mir vorkomme, als sei ich a) der einzige Mensch, der sie nicht verstanden hat, oder b) jemand, der nicht aufhören kann, rumzunörgeln, weil ich eine alte Grantwurzen bin. Beides furchtbare Vorstellungen.
Und dann kommt er wieder, der Gedanke: Es wird mir nie mehr gelingen, eine Perle aufzuspüren. Etwas zu fühlen beim Lesen. Ich bin übersättigt. Ich kenne alles. Und wer ist daran schuld? Ich selbst. Weil ich mir dauernd noch ein Buch und noch ein Buch in die Birne drücke. 100 im Jahr. Kein Wunder! Ständig hab ich das Gefühl: Das hab ich schon gelesen. Gleiches Storyboard, andere Namen, anderes Setting oder umgekehrt, aber trotzdem: Ich kenne das. Coming of Age, Generationenroman, Familienroman, amerikanisch, deutsch, russisch – ja. Alles schon dagewesen. Dauernd diese abgeschmackten Formulierungen, die sich ähnelnden Figuren, dieselben Emotionen, die ewige Nabelschau, das Kreisen der Figuren um sich selbst, und dieses Geschwurbel! Ich kann’s nicht mehr sehen. Und dann bin ich auch noch so bescheuert und will nie mehr als ein Buch vom selben Autor lesen, nicht mal, wenn es mir gefallen hat, erst recht nicht, wen es mir gefallen hat! Aber müsste ich nicht aus der unendlichen Flut der Neuerscheinungen etwas rausfiltern können, das wirklich neu ist? Müsste ich nicht in den Backlists Bücher entdecken, die interessant sind, ergreifend, gut?
Liegt es an mir? Oder ist die deutsche Gegenwartsliteratur momentan sehr einheitsbreiig? Bin ich zu kritisch, zu schnell genervt, zu ungeduldig, zu streng? Ich weiß es nicht. Vielleicht fische ich auch nur permanent im selben trüben Gewässer und sehe zu wenig über meinen Tellerrand hinaus. Was ich an Klassikern lesen wollte, hab ich schon gelesen. Viele Genres schließe ich inzwischen kategorisch aus. Womöglich ist meine Filterblase zu eingeschränkt, zu klein, zu eng. Oder mein Anspruch zu hoch. Aber: Kann er das überhaupt sein? Ich habe nicht viel Zeit zum Lesen, ich zwacke sie mir ab zwischen Kinder, Haushalt, Arbeiten, Herumhudeln und selber Schreiben, da will ich etwas lesen, das auch die Mühe wert ist. Ich habe nicht – wie viele andere Blogger – massenweise ungelesene Bücher, kein RuB, keine riesige Auswahl. Maximal 50 Titel liegen auf meinem SuB, aber das müsste doch eigentlich ausreichen, oder nicht? Doch dann steh ich da und starre diese Bücher an, keins interessiert mich genug, dass ich es auch nur in die Hand nehmen will.
Und es wird immer schlimmer mit meiner Leseunlust: Mittlerweile mag ich mir nicht mal mehr Bücher kaufen. Ist das zu fassen! Ich gehe in die Buchhandlung und gucke ratlos, die Neuheiten glotzen zurück, ohne dass ich mich dazu aufraffen kann, nach ihnen zu greifen. Wozu denn, denke ich, ist doch eh immer dasselbe. Das ist mir keine zwanzig Euro wert. Gut, ein Drittel der neuen Bücher hab ich meist bereits gelesen, ein weiteres Drittel spricht mich sowieso nicht an, weil Chicklit oder Vampire oder Crime, und der Rest? I just can’t be bothered. Wenn ich dann doch eins nehme, die U4 und die erste Seite lese, denke ich: Nä. Schnarch. Spontaner Gehirnschlaf. Die letzten Male hab ich die Buchhandlung ohne Buch verlassen – das wäre früher undenkbar gewesen. Auch die Verlagsvorschauen blättere ich durch, ohne eine Bestellung zu tätigen. Und irgendwie sitze ich in der Falle, denn: Lesen muss ich. Wie eine Alkoholikerin fühl ich mich, die befürchtet: Bald wird kein Schnaps mehr gebrannt. Ich definiere mich sehr stark über das Lesen. Deshalb kann ich es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, wenn es mir so geht wie jetzt und mich kein Buch begeistern kann. Was tue ich denn wirklich, wenn das für immer so bleibt?
Das ist Bullshit, natürlich, ich weiß das. Es ist nur eine Phase – wie man das eben so bei Kindern sagt, um sich selbst zu trösten. Und man sagt es ganz laut und oft und schreibt es vielleicht sogar in einen Blog, um das feine, leise Stimmchen zu übertönen, das einem zuflüstert, dass man sich vielleicht nur selbst belügt. Ich gebe nicht auf – wie könnte ich? Ich werde die Unlust wieder überwinden, ich hab das schon öfter geschafft. Es existieren mehr Bücher auf der Welt, als ich in hundert Leben lesen könnte. Da müssen doch noch ein paar gute dabei sein! Ich muss sie nur finden.
 Wir suchen DAS Buchtalent 2017: Der Gewinner bekommt einen Vertrag mit Klett-Cotta
Wir suchen DAS Buchtalent 2017: Der Gewinner bekommt einen Vertrag mit Klett-Cotta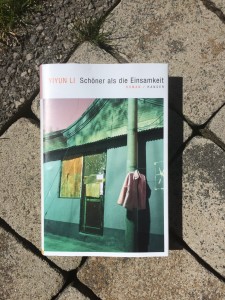 „Das beste Leben ist das nicht gelebte Leben“
„Das beste Leben ist das nicht gelebte Leben“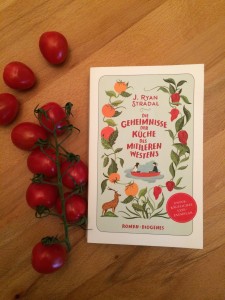 Eine höchst ungewöhnliche Menüabfolge
Eine höchst ungewöhnliche Menüabfolge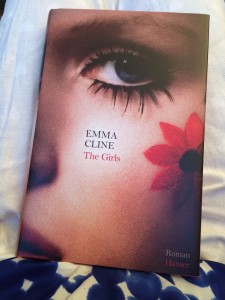 „Mein Schweigen hielt mich im Reich des Unsichtbaren“
„Mein Schweigen hielt mich im Reich des Unsichtbaren“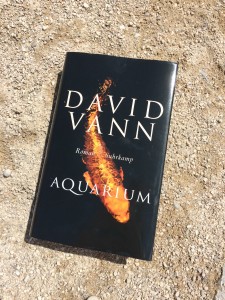 Von der Liebe zu den Fischen und dem Hass auf die Familie
Von der Liebe zu den Fischen und dem Hass auf die Familie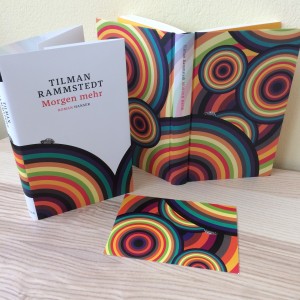 Während er schrieb …
Während er schrieb … Wenn ich eine Figur aus einem Roman wäre, dann … hätte ich sehr überraschend die Seiten gewechselt.
Wenn ich eine Figur aus einem Roman wäre, dann … hätte ich sehr überraschend die Seiten gewechselt.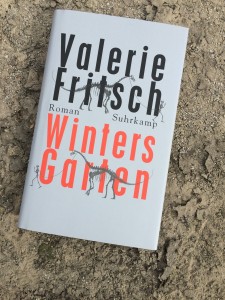 Valerie Fritsch ist 1989 in Graz geboren und hat an der Akademie für angewandte Photographie studiert. Sie arbeitet als Schriftstellerin und Photokünstlerin und hat seit ihrem 2011 erschienenen Debütroman Die
Valerie Fritsch ist 1989 in Graz geboren und hat an der Akademie für angewandte Photographie studiert. Sie arbeitet als Schriftstellerin und Photokünstlerin und hat seit ihrem 2011 erschienenen Debütroman Die 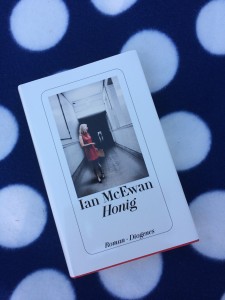 Spionage im England der Siebziger
Spionage im England der Siebziger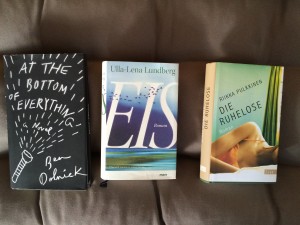 Aller guten Dinge sind drei, und dann ist auch mal wieder Schluss: Hier folgt der dritte und letzte (g)rantige Draufdrescher auf folgende Bücher, die mir das Leben schwergemacht haben.
Aller guten Dinge sind drei, und dann ist auch mal wieder Schluss: Hier folgt der dritte und letzte (g)rantige Draufdrescher auf folgende Bücher, die mir das Leben schwergemacht haben.