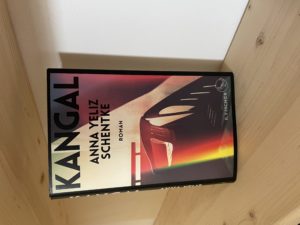 „Die Angst ist nachhaltig und wendig. Sie erwischt dich im Alltag, bei der Familie, auf der Arbeit, in der Liebe“
„Die Angst ist nachhaltig und wendig. Sie erwischt dich im Alltag, bei der Familie, auf der Arbeit, in der Liebe“
„Es konnte nicht die Lösung sein, dass sich nur die wehren, die nicht mehr anders können, wir mussten es alle gemeinsam machen.“ Tekin weiß, dass Delek Angst hatte. Angst davor, dass jemand sie verraten könnte. Dass der Staat herausfinden könnte, wer hinter dem Profil von Kangal steckt, die kritische Dinge ins Internet geschrieben hat. Tekin findet aber auch, dass Delek nicht einfach hätte abhauen sollen nach Deutschland. Weil gar nicht gesagt ist, dass es eine Akte über sie gibt, dass sie verhaftet, vernommen, eingesperrt wird. Delek wollte weg, solange es mit ihrem Pass noch möglich war. In Deutschland besorgt sie sich eine Wohnung, meldet sich bei ihrer Cousine Ayla, die sie lange nicht gesehen hat, weil ihre Mütter, die Schwestern waren, sich zerstritten haben – die eine hat in Deutschland geheiratet, die andere ist in der Türkei geblieben. Delek vermutet hinter dem Zerwürfnis politische Motive und merkt, dass die Türk:innen, die in Deutschland leben, sich kaum ausmalen können, welche Zustände in der Heimat tatsächlich herrschen.
Anna Yeliz Schentke hat ein beeindruckendes Buch geschrieben über das Leben unter dem türkischen Regime, über Terror, Widerstand und Angst. Sie schildert eine ganz spezielle Sprachlosigkeit: jene von Menschen, die nicht über die Gewalt reden können, die sie erfahren, weil sie sich dann noch mehr in Gefahr bringen – und weil ihnen nicht geglaubt wird. In sehr kurzen Kapiteln mit schnellen, wendigen Sprüngen und Ortswechseln zwischen Ayla, Delek und Tekin zeichnet sie ein Bild der jungen türkischen Generation, die sich zwar vernetzt, um aufzubegehren, aber auf verlorenem Posten kämpft, weil das System so viel stärker ist. Ist Deutschland eine Zuflucht oder nur eine weitere Falle, in der vielleicht nicht Gefängnis droht, aber Ausländerfeindlichkeit, soziale Kälte, Perspektivenlosigkeit? Wie man es auch dreht, es scheint keinen richtigen Weg für Dilek zu geben. Was sie am Ende tut, hat mich überrascht und ich konnte es nicht ganz nachvollziehen, wie überhaupt das Buch eine weitere Ebene zu haben scheint, die für mich unzugänglich war, weil ich kein Türkisch spreche. Ich fand es schwermütig, auf melancholische Weise fremd, traurig, brandaktuell und sehr gut.
Kangal von Anna Yeliz Schentke ist erschienen bei S. Fischer.
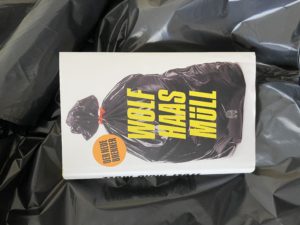 Ob du es glaubst oder nicht, der Wolf Haas ist mir schon oft unter die Nase gerieben worden. Der hat nämlich da studiert, wo ich auch studiert hab, nur ein bisserl früher. Und dann ist er so ein Paradebeispiel dafür geworden, dass man es schaffen kann, auch wenn man aus einem kleinen österreichischen Ort stammt. Er ist also was geworden, der Wolf Haas, vor allem der Autor vom Brenner. Jahrelang waren wir alle so heiß auf die Brenner-Krimis, Verehrung Hilfsausdruck. Dazu musst du wissen, dass sie die Essenz so gut eingefangen haben. Das Ranzige. Das Skifahren. Das Katholische. Das Grantige, Schimpferte. Und sowieso, die Sprache. Die hat er sich schon sehr fein zunutze gemacht, Geistesblitz nichts dagegen. Viele Formulierungen sind was Besonderes, das „Hilfsausdruck“ und „ob du es glaubst oder nicht“ und „jetzt ist schon wieder was passiert“. Irgendwann war es aber auch genug, muss man ehrlich sagen, der Brenner ist müde geworden und wir auch, acht Jahre ist der letzte Band her. Dass es nun einen neuen gibt, hat uns überrascht, die Branche fragt sich „hat der Verlag den Haas gezwungen“ oder „hat der Haas Geld gebraucht“ oder „ist ihm einfach fad geworden“, da ist es gleich hoch hergegangen mit den Spekulationen.
Ob du es glaubst oder nicht, der Wolf Haas ist mir schon oft unter die Nase gerieben worden. Der hat nämlich da studiert, wo ich auch studiert hab, nur ein bisserl früher. Und dann ist er so ein Paradebeispiel dafür geworden, dass man es schaffen kann, auch wenn man aus einem kleinen österreichischen Ort stammt. Er ist also was geworden, der Wolf Haas, vor allem der Autor vom Brenner. Jahrelang waren wir alle so heiß auf die Brenner-Krimis, Verehrung Hilfsausdruck. Dazu musst du wissen, dass sie die Essenz so gut eingefangen haben. Das Ranzige. Das Skifahren. Das Katholische. Das Grantige, Schimpferte. Und sowieso, die Sprache. Die hat er sich schon sehr fein zunutze gemacht, Geistesblitz nichts dagegen. Viele Formulierungen sind was Besonderes, das „Hilfsausdruck“ und „ob du es glaubst oder nicht“ und „jetzt ist schon wieder was passiert“. Irgendwann war es aber auch genug, muss man ehrlich sagen, der Brenner ist müde geworden und wir auch, acht Jahre ist der letzte Band her. Dass es nun einen neuen gibt, hat uns überrascht, die Branche fragt sich „hat der Verlag den Haas gezwungen“ oder „hat der Haas Geld gebraucht“ oder „ist ihm einfach fad geworden“, da ist es gleich hoch hergegangen mit den Spekulationen.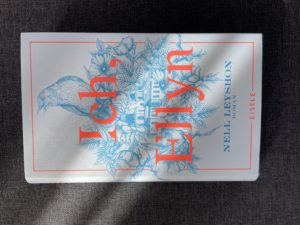 „Es reicht eine ununterbrochene Kette von uns Mädchen zu Frau zu Frau, die in der Vergangenheit durch alle toten Frauen geht und in die Zukunft zu allen ungeborenen Töchtern“
„Es reicht eine ununterbrochene Kette von uns Mädchen zu Frau zu Frau, die in der Vergangenheit durch alle toten Frauen geht und in die Zukunft zu allen ungeborenen Töchtern“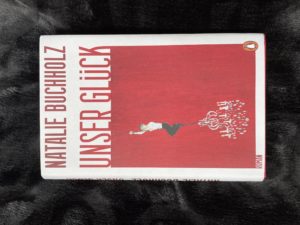 „Wir könnten uns so eine Wohnung niemals leisten“
„Wir könnten uns so eine Wohnung niemals leisten“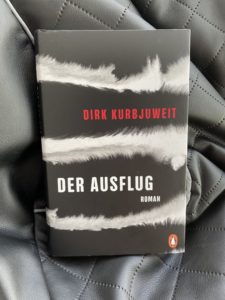 Es fängt einigermaßen harmlos an, Amalia und ihr Bruder Bodo sowie die gemeinsamen Freunde Josef und Gero unternehmen einen mehrtägigen Ausflug in ein Flussdelta. Sie mieten zwei Boote und paddeln sich quer durch die vielen Abzweige und Schleusen. Gleich am ersten Abend wird Josef rassistisch beleidigt, er ist der einzige Schwarze in der Freundesgruppe. Die anderen empören sich zwar, wollen den Ausflug aber nicht abbrechen. Das wird ihnen zum Verhängnis, denn plötzlich beginnt eine krasse Verfolgungsjagd durch unübersichtliche Gewässer, sie verirren sich heillos, können niemandem mehr trauen – nicht einmal oder schon gar nicht einander.
Es fängt einigermaßen harmlos an, Amalia und ihr Bruder Bodo sowie die gemeinsamen Freunde Josef und Gero unternehmen einen mehrtägigen Ausflug in ein Flussdelta. Sie mieten zwei Boote und paddeln sich quer durch die vielen Abzweige und Schleusen. Gleich am ersten Abend wird Josef rassistisch beleidigt, er ist der einzige Schwarze in der Freundesgruppe. Die anderen empören sich zwar, wollen den Ausflug aber nicht abbrechen. Das wird ihnen zum Verhängnis, denn plötzlich beginnt eine krasse Verfolgungsjagd durch unübersichtliche Gewässer, sie verirren sich heillos, können niemandem mehr trauen – nicht einmal oder schon gar nicht einander.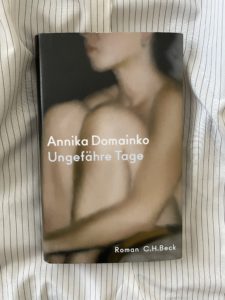 „Wir standen einander gegenüber, mit hängenden Armen“
„Wir standen einander gegenüber, mit hängenden Armen“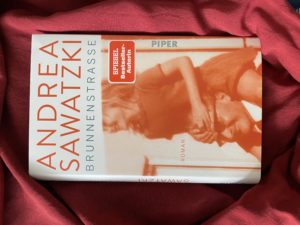 „Ich wurde zu einem Mädchen, das niemand lieb haben konnte“
„Ich wurde zu einem Mädchen, das niemand lieb haben konnte“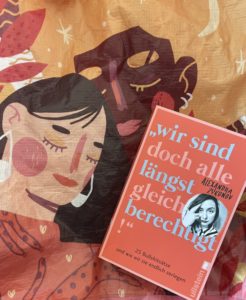 Ich habe bei diesem Buch so heftig genickt wie schon lange nicht mehr: Alle 25 Sätze, die Alexandra Zykunov darin auf fundierte Art und Weise zerlegt, habe ich oft genug gesagt bekommen. Und jetzt, nach der Lektüre, fühle ich mich gestärkt und habe etwas an der Hand, das ich dringend brauche, um in diesen Diskussionen zu bestehen: Fakten. Die Redakteurin für feministische Themen, deren Posts regelmäßig viral gehen, hat ein Buch geschrieben, das nicht nur aufzeigt, wie es um die reale Lebenswirklichkeit von Frauen im Jahr 2022 bestellt ist, sie gibt uns damit auch etwas sehr Praktisches an die Hand: Argumente. Widerworte. Beweise. Harte Tatsachen. Und die sind wichtig, wenn man wieder einmal ausgebremst wird mit einem „du hast es aber gut, dass dein Mann dir so viel hilft“ oder einem „Frauen wollen eh keine Karriere machen“, gefolgt von „ich liebe meine Kinder, ich kann fürs Kümmern doch kein Geld verlangen“ und „Frauen müssten so verhandeln wie Männer“. Wie ich es satthabe!
Ich habe bei diesem Buch so heftig genickt wie schon lange nicht mehr: Alle 25 Sätze, die Alexandra Zykunov darin auf fundierte Art und Weise zerlegt, habe ich oft genug gesagt bekommen. Und jetzt, nach der Lektüre, fühle ich mich gestärkt und habe etwas an der Hand, das ich dringend brauche, um in diesen Diskussionen zu bestehen: Fakten. Die Redakteurin für feministische Themen, deren Posts regelmäßig viral gehen, hat ein Buch geschrieben, das nicht nur aufzeigt, wie es um die reale Lebenswirklichkeit von Frauen im Jahr 2022 bestellt ist, sie gibt uns damit auch etwas sehr Praktisches an die Hand: Argumente. Widerworte. Beweise. Harte Tatsachen. Und die sind wichtig, wenn man wieder einmal ausgebremst wird mit einem „du hast es aber gut, dass dein Mann dir so viel hilft“ oder einem „Frauen wollen eh keine Karriere machen“, gefolgt von „ich liebe meine Kinder, ich kann fürs Kümmern doch kein Geld verlangen“ und „Frauen müssten so verhandeln wie Männer“. Wie ich es satthabe!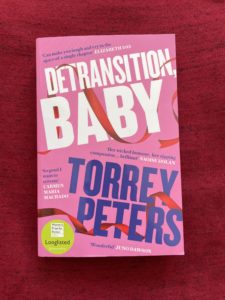 „The past is the past to everyone but ghosts“
„The past is the past to everyone but ghosts“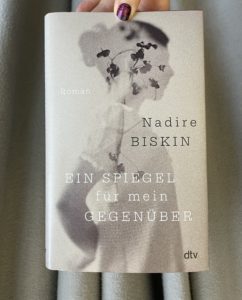 „Die Geschichte der Müdigkeit, die Geschichte des Hamsterrads, die Geschichte des Ungenügendseins“
„Die Geschichte der Müdigkeit, die Geschichte des Hamsterrads, die Geschichte des Ungenügendseins“