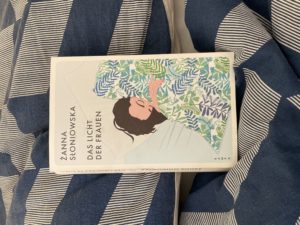 „Lassen wir den Inhalt beiseite, reden wir über Emotionen. Du hast viel zu viele“
„Lassen wir den Inhalt beiseite, reden wir über Emotionen. Du hast viel zu viele“
Die Männer sind abwesend. Die Männer sind im Krieg oder wurden verhaftet, sie sind tot und in ihrer Abwesenheit dennoch präsent, aber den Alltag bestreiten die Frauen allein: In einem alten Haus in Lemberg, das sich durch eine besondere Glasmalerei auszeichnet, lebt die Ich-Erzählerin mit ihrer Mutter, Großmutter und Urgroßmutter. Die Mutter, Marianna, ist eine gefragte und bekannte Opernsängerin, die sich in der aufwallenden Revolte der 1990er-Jahre für die Unabhängigkeit der Ukraine einsetzt. Sie wird auf offener Straße erschossen und fortan müssen die drei verbliebenen Frauen versuchen, nicht nur mit der großen Lücke umzugehen, die Marianna hinterlassen hat, sondern auch eine Antwort zu finden auf die Frage, ob sie für die richtige Sache gestorben ist – ob es so eine Sache überhaupt gibt, ob Politik es jemals wert sein kann, den Tod in Kauf zu nehmen. In nicht chronologischem Wechsel wird erzählt von Kindheit und Jugend sowie von der späteren Affäre mit dem Liebhaber von Marianna, auf die die Protagonistin sich vermutlich einlässt, um die Mutter auf diese Weise bei sich zu haben.
Zwar kann ich die Idee des Mannes als Stellvertreter, als Platzhalter für die Liebe zur Mutter, die ins Leere geht, verstehen, und doch war dies der Teil, der mir an Żanna Słoniowskas Roman weniger gefallen hat, weil ich die „Dreiecksgeschichte mit der toten Mutter“, wie es im Buch genannt wird, eher befremdlich fand. Die erste Hälfte dagegen hat mich vor allem sprachlich beeindruckt, Żanna Słoniowska findet großartige Bilder für diese tragische Geschichte, für diese Zeit der Frauen, die jetzt, durch die Geschehnisse in der Ukraine, an neuer Aktualität gewonnen hat. Die Autorin selbst nennt Russisch, Polnisch und Ukrainisch als ihre Muttersprachen, und ihre eigene Biografie zeigt, wie eng diese Länder immer schon verbunden waren: nicht nur durch die Sowjetunion, sondern durch die Menschen, die länderübergreifend verliebt waren, zusammengearbeitet und Familien gegründet haben. In „Das Licht der Frauen“ stehen eben nicht die vermeintlichen „Helden“ im Mittelpunkt, die an der Front kämpfen, es legt den Fokus auf ein Beziehungsgeflecht von Frauen, es ist eindrucksvoll, melancholisch und traurig.
Im Video auf der Website des Verlags sagt Żanna Słoniowska, dass Poesie und Literatur in der Ukraine und in Russland zum Alltag gehören, dass sie zu ihrer Mutter, die Journalistin war und immerzu gelesen hat, nur durchdringen konnte, indem sie mit ihr über Bücher sprach. Literatur ist Leben, sagt sie, das sind keine zwei getrennten Dinge.
Das Licht der Frauen von Żanna Słoniowska ist erschienen bei Kampa.
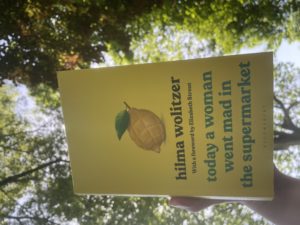 „Motherhood could make some women whitewash anything“
„Motherhood could make some women whitewash anything“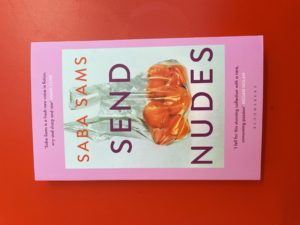 „We have one final trick, they said, and then they jumped“
„We have one final trick, they said, and then they jumped“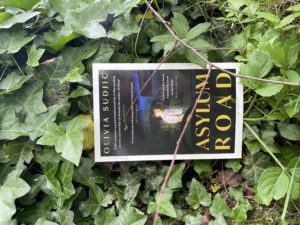 Anya ist mit ihrem Freund Luke im Urlaub und hat das Gefühl, dass die Beziehung eigentlich am Zerbrechen ist. Zwar kommunizieren sie noch, reden aber oft aneinander vorbei. Anya, die mit ihrer Schwester aus Ex-Jugoslawien geflüchtet ist, trägt schwer an dieser Vergangenheit, Luke ist allerdings ebenfalls unzugänglich und launisch. Doch zu Anyas Überraschung macht Luke ihr einen Antrag, und sie kehren als Verlobte nach London zurück. Bald darauf machen sie sich zum ersten Mal gemeinsam auf den Weg in Anyas ehemalige Heimat, wo sie zunächst auf die Hilfe einer früheren Freundin angewiesen sind, weil Anya ihr Notizbuch und ihr Handy im Flugzeug vergisst und die Adresse ihrer Eltern nicht weiß. Nach dem Besuch in Kroatien reisen sie nachhause zurück, und es stellt sich heraus, dass Anyas ursprüngliches Gefühl doch nicht so falsch war.
Anya ist mit ihrem Freund Luke im Urlaub und hat das Gefühl, dass die Beziehung eigentlich am Zerbrechen ist. Zwar kommunizieren sie noch, reden aber oft aneinander vorbei. Anya, die mit ihrer Schwester aus Ex-Jugoslawien geflüchtet ist, trägt schwer an dieser Vergangenheit, Luke ist allerdings ebenfalls unzugänglich und launisch. Doch zu Anyas Überraschung macht Luke ihr einen Antrag, und sie kehren als Verlobte nach London zurück. Bald darauf machen sie sich zum ersten Mal gemeinsam auf den Weg in Anyas ehemalige Heimat, wo sie zunächst auf die Hilfe einer früheren Freundin angewiesen sind, weil Anya ihr Notizbuch und ihr Handy im Flugzeug vergisst und die Adresse ihrer Eltern nicht weiß. Nach dem Besuch in Kroatien reisen sie nachhause zurück, und es stellt sich heraus, dass Anyas ursprüngliches Gefühl doch nicht so falsch war. „Die künstliche Bewertung menschlicher Arbeit bringt die Frau in eine ausgesprochen ungünstige Position“
„Die künstliche Bewertung menschlicher Arbeit bringt die Frau in eine ausgesprochen ungünstige Position“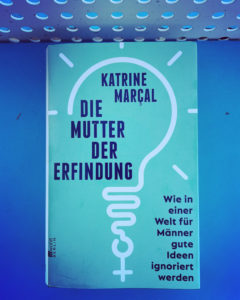 „Wenn man Frauen nicht mit in den Blick nimmt, ergibt sich ein verzerrtes Bild der Menschheit“
„Wenn man Frauen nicht mit in den Blick nimmt, ergibt sich ein verzerrtes Bild der Menschheit“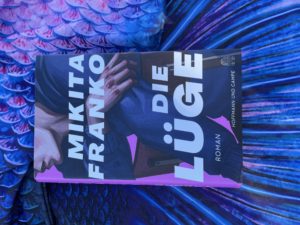 „Dass dich ein nahestehender Mensch verrät und ein Fremder rettet“
„Dass dich ein nahestehender Mensch verrät und ein Fremder rettet“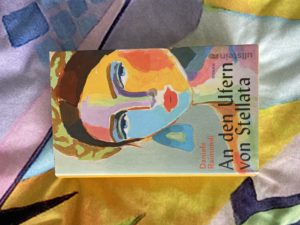 „Die Toten haben viel mehr Macht als diejenigen, die auf der Erde zurückbleiben“
„Die Toten haben viel mehr Macht als diejenigen, die auf der Erde zurückbleiben“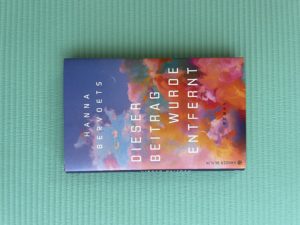 „Na, Liebes, dann hast du doch alles getan, was du konntest?“
„Na, Liebes, dann hast du doch alles getan, was du konntest?“ „In jener Zeit gehörte das, was einmal meins war, nicht mehr mir. Zuallererst mein Körper“
„In jener Zeit gehörte das, was einmal meins war, nicht mehr mir. Zuallererst mein Körper“