 „Ein bisschen Liebe hat noch keinem geschadet“
„Ein bisschen Liebe hat noch keinem geschadet“
Mara ist Schriftstellerin, und jedes Jahr verbringt sie den gesamten Sommer auf einer kleinen kroatischen Insel. Sie ist fremd hier, aber trotzdem auch ein bisschen zuhause, sie kennt die Menschen dort, die Sitten, das Wechselspiel der Winde. Doch genau die spielen in jenem einen Sommer irgendwie verrückt: Die Bora weht ungewöhnlich heftig und treibt die Inselbewohner in den Wahnsinn. Es könnte also einfach am Wetter liegen, dass Mara so aus der Bahn geworfen wird, als sie auf den Fotografen Andrej trifft. Oder es ist vielleicht doch ein wenig Verliebtheit im Spiel. Er hat kroatische Wurzeln und ist ein ebenso attraktiver wie interessanter Mann. Mara rauschen die Hormone durchs Blut, sie fühlt und benimmt sich wie ein Teenager, Andrej zieht sie an wie ein Magnet. Und als sie zueinanderfinden, ist es einfach gut und richtig: „Andrej wuchs in mein Inselleben hinein wie eine Schraube, die sich in ein Gewinde dreht. Normalerweise brachten Männer alles durcheinander, sobald sie in meinem Leben auftauchten. Immer zogen sie Bausteine von ganz unten aus meinem Gebäude und setzten sie ganz obendrauf, wo sie mir die Sicht auf die Welt verstellten, während ich damit beschäftigt war, das Ding stabil zu halten, trotz der plötzlichen Lücken im Fundament. Andrej ließ alles, wo es war, und setzte seine Steine dahin, wo Platz war.“ Nur leider ist das Problem dieses Sommers dasselbe wie mit jedem Sommer: Er kann nicht ewig dauern …
Ich mag Ruth Cerha. Ich mochte sie schon bei Kopf in den Wolken, ihrem hervorragenden zweiten Buch. Und dank Bora. Eine Geschichte vom Wind mag ich sie nun noch mehr. Weil sich die beiden Romane stark voneinander unterscheiden: Wo der eine melancholisch und poetisch war, ist der andere heiter und gefühlvoll. Und weil sie beide gut sind. Die Hauptstimme dieses herrlichen Sommerbuchs gehört Mara, aber auch Andrej kommt zwischendurch zu Wort – und der Perspektiven- bzw. Stilwechsel ist der Autorin gut gelungen. So entsteht ein vollständiges Bild dieser frisch aufflammenden Liebe. Obwohl ich traurig-düstere sowie fies-sarkastische Bücher liebe, schlägt mein Herz auch für Lovestorys. Wenn sie niveauvoll sind. Ich finde es schön, wenn zwei sich treffen, sich sehen bis innendrin, sich erkennen, sich lieben, wenn alles zusammenpasst und ineinander fällt.
Genauso ist es in Bora. Eine Geschichte vom Wind. Mara und Andrej haben sich – um die ausgelutschte Floskel zu bemühen – gesucht und gefunden. Es hat mir ein fettes Grinsen ins Gesicht gesetzt, wie Mara anfangs versucht, Andrejs Anziehungskraft zu widerstehen, und wie lächerlich süß sie sich dabei benimmt. Denn es ist egal, ob man ein Teenie ist oder Ende vierzig: Wenn die Schmetterlinge durch den Bauch tanzen, kann man nicht mehr klar denken. Während der Lektüre war ich gespannt auf das Ende. Würde Ruth Cerha es schaffen, weiterhin so grandios den Kitsch zu umschiffen und trotzdem einen stimmigen Schluss finden? Die Antwort lautet: Ja. Das passt gut zusammen, wie Mara und Andrej, wie dieser Roman und der Sommer, wie Ruth Cerha und ich.
Bora. Eine Geschichte vom Wind von Ruth Cerha ist erschienen in der Frankfurter Verlagsanstalt (ISBN 978-3-627-00215-2, 256 Seiten, 19,90 Euro). Interessante Rezensionen zum Buch findet ihr auf We read Indie, Revolution, Baby, Revolution, Buchrevier und bei Frau Hauptsachebunt.



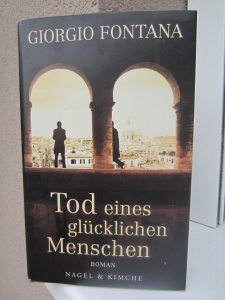
 ist nicht möglich, die eigene Haut ganz abzustreifen, in die von jemand anderem zu schlüpfen“
ist nicht möglich, die eigene Haut ganz abzustreifen, in die von jemand anderem zu schlüpfen“





