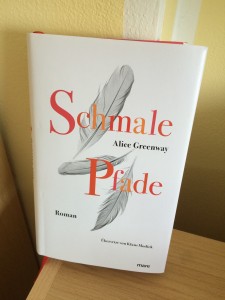 Über einen, der erstarrt ist unter der Kruste der Vergangenheit
Über einen, der erstarrt ist unter der Kruste der Vergangenheit
Jim Kennoway ist alt. Er lebt zurückgezogen auf einer Insel vor Maine, einer Insel, die er schon als Junge geliebt hat. Jetzt will Jim seine Ruhe haben, er will trinken und sich selbst leidtun. En Bein musste ihm amputiert werden, was ihm große Schwierigkeiten bereitet. Da reißt ihn plötzlich ein junges Mädchen aus seiner Lethargie: Sie hat schwarze Haut, heißt Cadillac Baketi und ist die Tochter von Tosca. 1943, dreißig Jahre zuvor, hat Jim im Pazifikkrieg mit Tosca zusammen japanische Schiffe ausgespäht. Sie haben gekämpft. Sie haben getötet. Und all das will Jim, der später als Ornithologe sehr erfolgreich war, einfach nur vergessen. Doch die Anwesenheit der jungen Salomonerin, die bald in Yale Medizin studieren soll, bewirkt das genaue Gegenteil: Jahrzehntelang verschüttete Erinnerungen schwappen hoch. Vielleicht ist es ja an der Zeit, endlich mit ihnen abzuschließen.
Vor einigen Jahren – genauer gesagt 2009 – fand ich Alice Greenways Roman White Ghost Girls grandios. Für ihren Zweitling hat sie sich ein Weilchen Zeit gelassen. Die war bestimmt auch für die Recherche nötig, denn Schmale Pfade führt mich an einen ungewöhnlichen Ort – eine Insel, von der ich nie zuvor gehört habe – und in einen Krieg, über den ich nichts weiß. Dieses Setting finde ich ausgesprochen interessant, genauso wie die Lebensumstände der Inselbewohner, die historischen Zusammenhänge und die vielen Beschreibungen diverser Vogelarten. Auch damit muss Alice Greenway sich ausführlich beschäftigt haben.
Trotz des großen Interesses meinerseits werde ich mit Schmale Pfade nicht so richtig warm – und ich kann die Gründe dafür nicht wirklich fassen. Liegt es daran, dass der Protagonist ein unsympathischer Grantler ist? Das stört mich für gewöhnlich nicht, es amüsiert mich meistens eher. Oder daran, dass Cadillac einfach nur anwesend ist, ohne dass ihre Persönlichkeit ausgeleuchtet wird? Das finde ich in der Tat schade. Sie ist der Auslöser für alles, bleibt aber dennoch verschwommen, nicht greifbar, als genüge ihre Funktion allein. Ich bekomme Infos über sie – aber kein Gefühl für sie. Das Buch liest sich gut, doch der emotionale Zugang bleibt mir auch insgesamt verwehrt. Keiner der Figuren gelingt es, mich zu erweichen. Das ist nicht weiter schlimm, bei manchen Büchern zündet es, bei anderen eben nicht. Und es bedeutet nicht, dass ich euch von diesem Roman abraten möchte, im Gegenteil: Bildet euch am besten selbst ein Urteil. Denn schreiben kann Alice Greenway tatsächlich sehr gut, mit einer Tiefe und zugleich einer Leichtigkeit, die verblüfft. Und meine leichte Enttäuschung ist auf jeden Fall subjektiv: Die Klappentexterin, Herzpotenzial sowie Leseschatz fanden das Buch beispielsweise wunderbar. Ich dagegen bin immer noch verliebt in die White Ghost Girls.
Schmale Pfade von Alice Greenway ist erschienen im mare Verlag (ISBN 978-3-86648-232-6, 368 Seiten, 22 Euro).
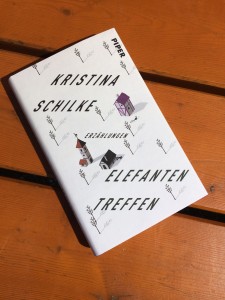 „Und das Gute an der Vergangenheit ist, dass es einem völlig freisteht, sich nicht mehr an sie zu erinnern“
„Und das Gute an der Vergangenheit ist, dass es einem völlig freisteht, sich nicht mehr an sie zu erinnern“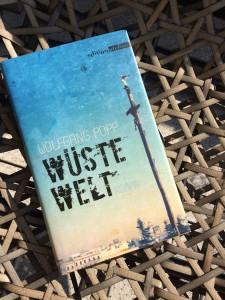 „Man muss einfach den Weg nehmen, den der Sand einem lässt“
„Man muss einfach den Weg nehmen, den der Sand einem lässt“
 Wenn ich eine Figur aus einem Roman wäre, dann ein moralisch fragwürdiger Antiheld oder der würdevolle Verlierer (der aber natürlich trotzdem das Mädchen bekommt) aus einem klassischen Roman noir.
Wenn ich eine Figur aus einem Roman wäre, dann ein moralisch fragwürdiger Antiheld oder der würdevolle Verlierer (der aber natürlich trotzdem das Mädchen bekommt) aus einem klassischen Roman noir.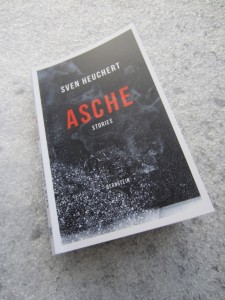
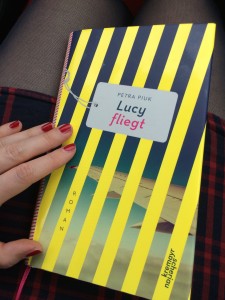 Eine perfide Persiflage auf die „Generation GNTM“
Eine perfide Persiflage auf die „Generation GNTM“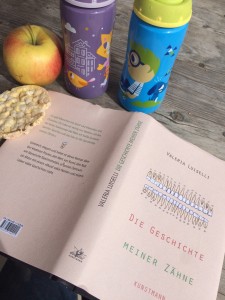 Verrückt, verrückter, Luiselli
Verrückt, verrückter, Luiselli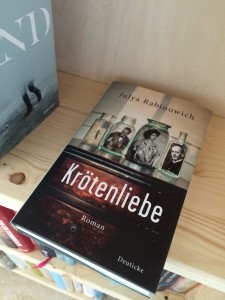 „Die Schönheit der Kröte erschließt sich nicht jedem“
„Die Schönheit der Kröte erschließt sich nicht jedem“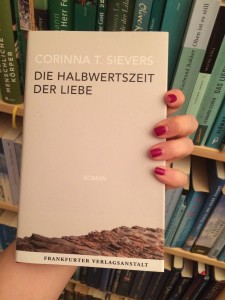 „Mit Frauen ist es wie mit Gott, du kannst sie fürchten und anbeten, aber am Ende vernichten sie dich immer“
„Mit Frauen ist es wie mit Gott, du kannst sie fürchten und anbeten, aber am Ende vernichten sie dich immer“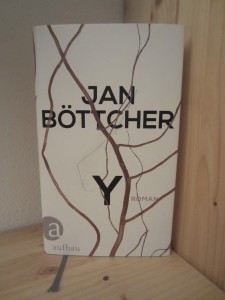 „Jemanden gehen zu lassen, obwohl man ihn liebt, weil man ihn liebt“
„Jemanden gehen zu lassen, obwohl man ihn liebt, weil man ihn liebt“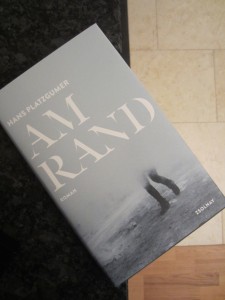 „Was immer wir erinnern, wir haben es nicht gegoogelt, sondern erlebt“
„Was immer wir erinnern, wir haben es nicht gegoogelt, sondern erlebt“