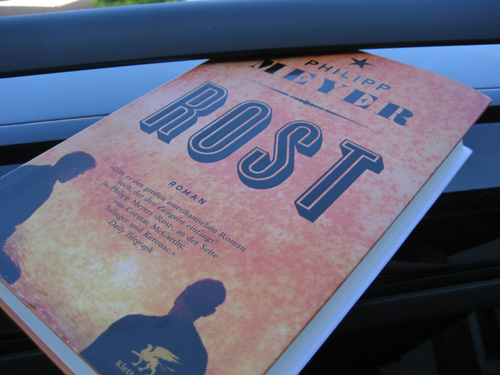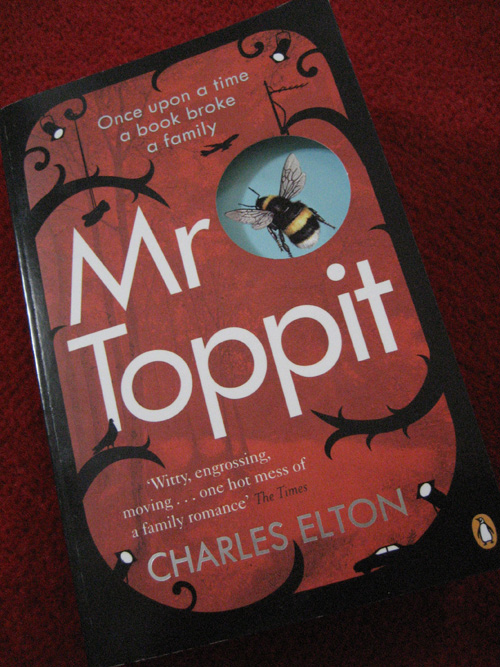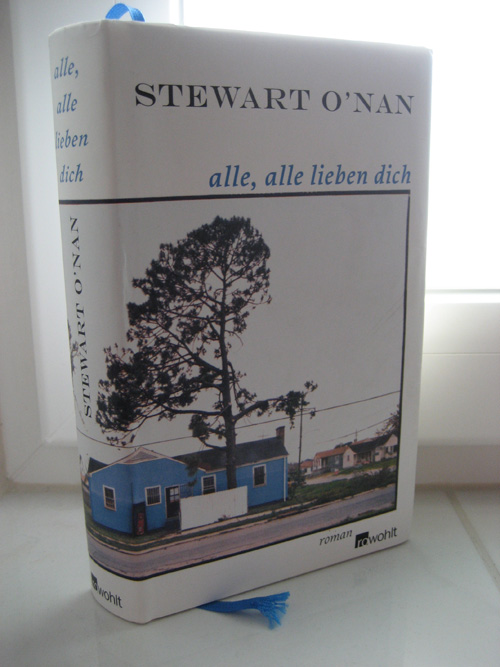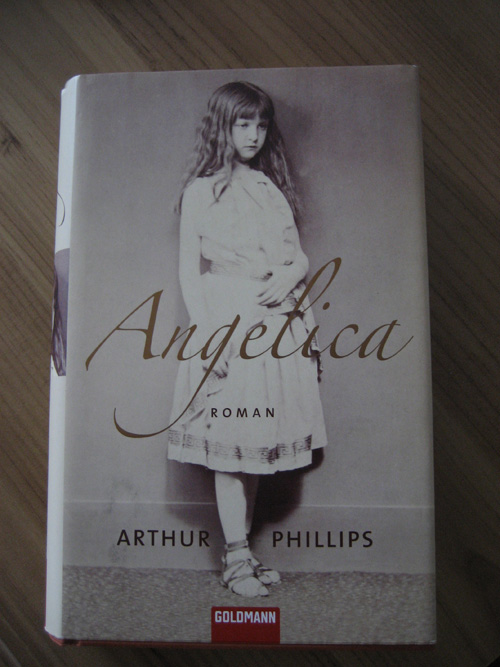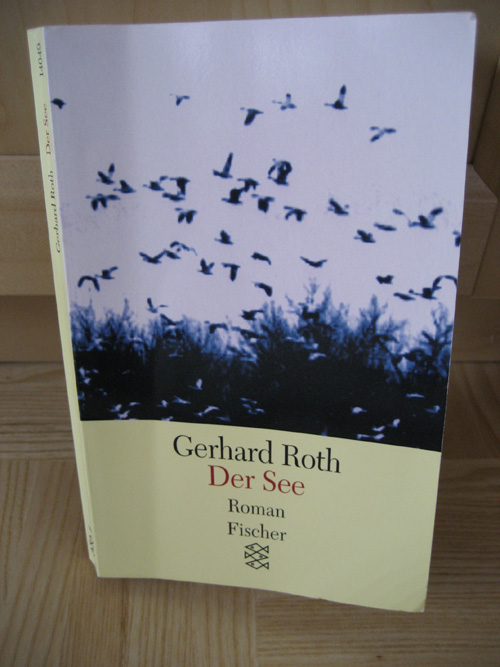“Ich glaube, ich bin eine Biene, die durch den Supermarktgarten fliegt”
“Ich glaube, ich bin eine Biene, die durch den Supermarktgarten fliegt”
Ein Mann geht einkaufen im Supermarkt. Und da ereignet sich etwas, das man vielleicht bemerkenswert nennen könnte: Er wählt vier Äpfel aus, die zusammen genau 1000 Gramm wiegen. Deshalb erwacht in ihm die Hoffnung, dieser Tag möge ein besonderer sein. Das täte ihm gut, geschieht doch sonst herzlich wenig in seinem Leben, seit L. ihn verlassen hat. Und wie er so durch den Supermarkt spaziert, sich seine Gedanken macht über die Farbe von Strumpfhosen, über Werbung und bunte Verpackungen und über die Möglichkeit, selbst verwurstet zu werden, wird er ganz philosophisch, verliert sich in Überlegungen: “Und der Tod, so kommt’s mir vor, schiebt seinen Einkaufswagen neben mir. Und legt die Leben, die er nimmt, hinein. Und an der Kasse muß er nicht bezahlen.”
Vier Äpfel ist ein Roman auf Sparflamme: Nicht nur wegen der gerade mal 158 luftig gesetzten Seiten, sondern vor allem inhaltlich. Ein Mann geht einkaufen und – na ja, und nichts. Viel braucht er nicht, lebt er doch allein, seit L. weg ist, an die er noch voll Wehmut denkt: “Nur L. war perfekt, an ihr hat mich gar nichts gestört, aber das ist eine Lüge der Erinnerung.” Leider erzählt er dem Leser aber viel zu wenig von L., als dass man einen Einblick in diese zu Ende gegangene Beziehung gewinnen könnte. L. bleibt eine Schattenfigur, der keine tragende Rolle mehr zukommt. Worüber also kann man sich während des Einkaufens den Kopf zerbrechen? Über die guten alten Zeiten, in denen Oma noch selbst ihr Obst erntete und einkochte, über Single-Shopping mit Flirtmöglichkeit, über Preisaktionen. In Fußnoten bringt David Wagner durchaus interessantes Allgemeinwissen unter die Leser, beispielsweise über den Erfinder der Fischstäbchen oder des Drehkreuzes. Mir persönlich ist das aber alles zu wenig für ein lesenswertes Buch, Vier Äpfel ist mehr eine Momentaufnahme, das Festhalten eines Einkaufs zur heutigen Zeit. Das ist recht nett, aber nicht mehr, hat keine Tiefe und – so viel nehme ich vorweg – erfüllt die Hoffnung nicht: Die Frage, ob das Gewicht der vier Äpfel etwas Besonderes auslöst, lautet leider Nein.