 Eine perfide Persiflage auf die „Generation GNTM“
Eine perfide Persiflage auf die „Generation GNTM“
„Ich ändere meinen Namen auf Facebook von Linda auf Lucy. Und meinen Wohnort von Floridsdorf auf Hollywood. Ich weiß, dass ich noch nicht in Hollywood war, aber es geht ja um die Zielvisualisierung und wenn du jeden Tag Floridsdorf liest, dann bleibst du in Floridsdorf, aber wenn du jeden Tag Hollywood liest, dann fliegen dir die Möglichkeiten, nach Hollywood zu kommen, nur so zu.“ Und nach Hollywood will Lucy unbedingt, also uuunbedingt, wirklich, wirklich, so sehr, dass sie alles dafür tut. Das Mädchen aus dem Wiener Plattenbau ist überzeugt davon, dass es eine große Schauspielerin werden wird, und übt schon als Kind die Oscarrede. Das echte Leben ist fad und ohne Perspektiven, aber Lucy lässt sich nicht unterkriegen: Sie glaubt an sich, sie kellnert und spart, sie schläft mit vermeintlichen Regisseuren und zieht sich aus, um an Rollen zu kommen. Sie sieht nichts anderes vor Augen als Hollywood – und sei es noch so weit weg. Sie lässt sich von nichts abhalten: nicht von den Neidern und Klatschweibern, nicht von den vielen Peinlichkeiten und Hindernissen, nicht von fehlendem Talent oder Geld, nicht von der Liebe und nicht von einer Schwangerschaft …
Lucy fliegt von Petra Piuk ist eine Persiflage. Auf ebenso kluge wie eindringliche Weise thematisiert sie den Wahn, dem junge Menschen ihm Zuge von DSDS, GNTM und Konsorten verfallen, immer den schnellen Ruhm vor Augen, der durch die Medien und Fernsehformate so erreichbar und greifbar erscheint. Jeder kann heutzutage berühmt werden, und Protagonistin Lucy ist entschlossen, die Chance – die es nicht gibt – zu nutzen. In einem atemlosen, gehetzten Monolog voll unfertiger Sätze und Ich-red-mir-ein-dass-alles-gut-ist-Mantras erzählt die österreichische Autorin, die im Doku-Soap-Bereich gearbeitet hat und sich somit bestens auskennt, in ihrem ersten Roman von einer Seifenblasenwelt und von Träumen, die zerplatzen. Herrlich ist dabei ihr sarkastischer Ton, der das ganze Buch durchtränkt und die Bitterkeit von Lucys Leben spürbar macht. Das Mädchen geht mit sich selbst hart ins Gericht, doch zwischen all den Durchhalteparolen wallt Verzweiflung auf. Lucy ist völlig blind für die Mechanismen, denen sie sich freiwillig unterwirft: Schon früh setzt sie auf Sex, um beliebt zu sein, und merkt nicht, wie sie sich verschenkt, verheizt, verbrennt. Die, die über sie reden, sind doch nur neidisch, tröstet sie sich. Und springt von einer Falle, die das Leben ihr stellt, in die nächste.
„Die Mama sagt: Und die Gitti, die sich die Brüste fürs Fernsehen machen hat lassen, spricht auch jeder drauf an. Die nennen sie Titti-Gitti, sage ich. Die Mama sagt: Die meinen das ja lieb.“
So klingt Lucy fliegt, und es ist ein böses Buch. Jede Wendung ist schlimmer als die davor, und obwohl die Monolog-Erzählvariante zum Teil wahnsinnig anstrengend ist, ist sie auch genial: Petra Piuk lässt Lucy selbst berichten, was geschehen ist, und schafft es dennoch, die verurteilende Außenwelt sichtbar zu machen. Das ist spannender als ein schlicht chronologisches Erzählen. Alle lachen Lucy aus. Während sie fest an ihren Traum glaubt, nimmt in Wahrheit niemand sie ernst.
„Ich gehe nach Hollywood und hole mir den Oscar, ihr werdet schon noch alle sehen. Du und dein Oscar, sagt die Mama, einen Oscar kannst du höchstens als Freund haben.“
Lucy will entkommen, will dem tristen Leben im Wiener Problembezirk entfliehen, doch sie hat sich ein Ziel gesetzt, das nicht zu erreichen ist. Sie kämpft, sie hält den Kopf über Wasser, sie will nicht untergehen. Ich finde ihre Naivität und Skrupellosigkeit unerträglich und leide zugleich mit ihr. Dass wir eine Jugend heranzüchten, die sich verrennt in den Glauben, Glamour, Schönheit und Ruhm mache glücklich, ist beängstigend. Lucy ist eine fiktive Figur und könnte trotzdem nicht realer sein. Das alles zu lesen, ist amüsant, doch das Lachen bleibt mir im Hals stecken, und am Ende des Buchs bin ich bekümmert. Petra Piuk hat nicht nur ein Mädchen, sondern eine halbe Generation porträtiert, die nach Bekanntheit und Beifall giert – um jeden Preis. Denn das Leben, das sie führt, bedeutet ihr gar nichts.
Lucy fliegt von Petra Piuk ist erschienen im Verlag Kremayr & Scheriau (ISBN 978-3-218-01026-9, 192 Seiten, 19,90 Euro).

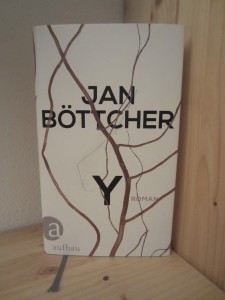 „Jemanden gehen zu lassen, obwohl man ihn liebt, weil man ihn liebt“
„Jemanden gehen zu lassen, obwohl man ihn liebt, weil man ihn liebt“ „Wir müssen unsere Eltern verraten, um zu wachsen“
„Wir müssen unsere Eltern verraten, um zu wachsen“ „Der Alltag ist ein Schmetterling“
„Der Alltag ist ein Schmetterling“
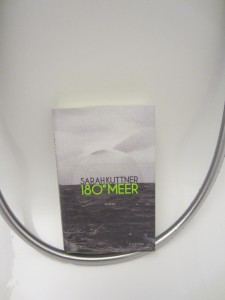 „Ohne Wut wäre ich vielleicht ein schönerer Mensch, aber auch weniger Mensch“
„Ohne Wut wäre ich vielleicht ein schönerer Mensch, aber auch weniger Mensch“ „Wusstest du, dass es einen Ort gibt, wo es besser ist als überall sonst?“
„Wusstest du, dass es einen Ort gibt, wo es besser ist als überall sonst?“
 „Manchmal habe ich das Gefühl, dass schon hinter kleinsten Rissen ein Abgrund klafft“
„Manchmal habe ich das Gefühl, dass schon hinter kleinsten Rissen ein Abgrund klafft“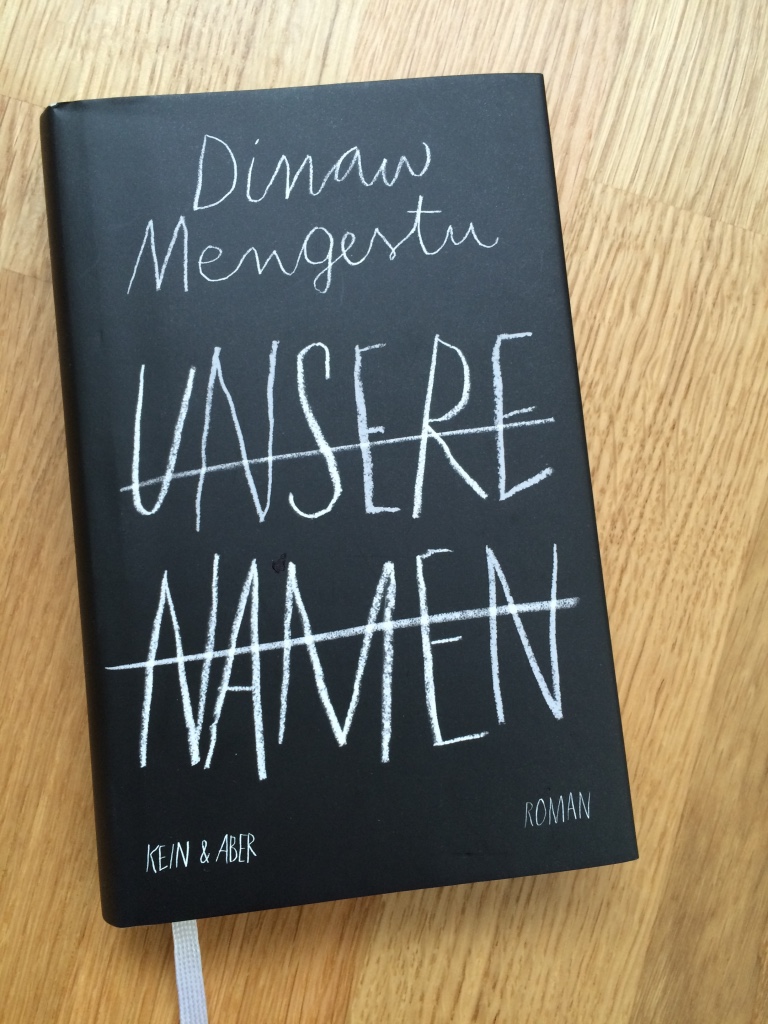 „Isaac und ich wurden Freunde wie zwei streunende Hunde“
„Isaac und ich wurden Freunde wie zwei streunende Hunde“


