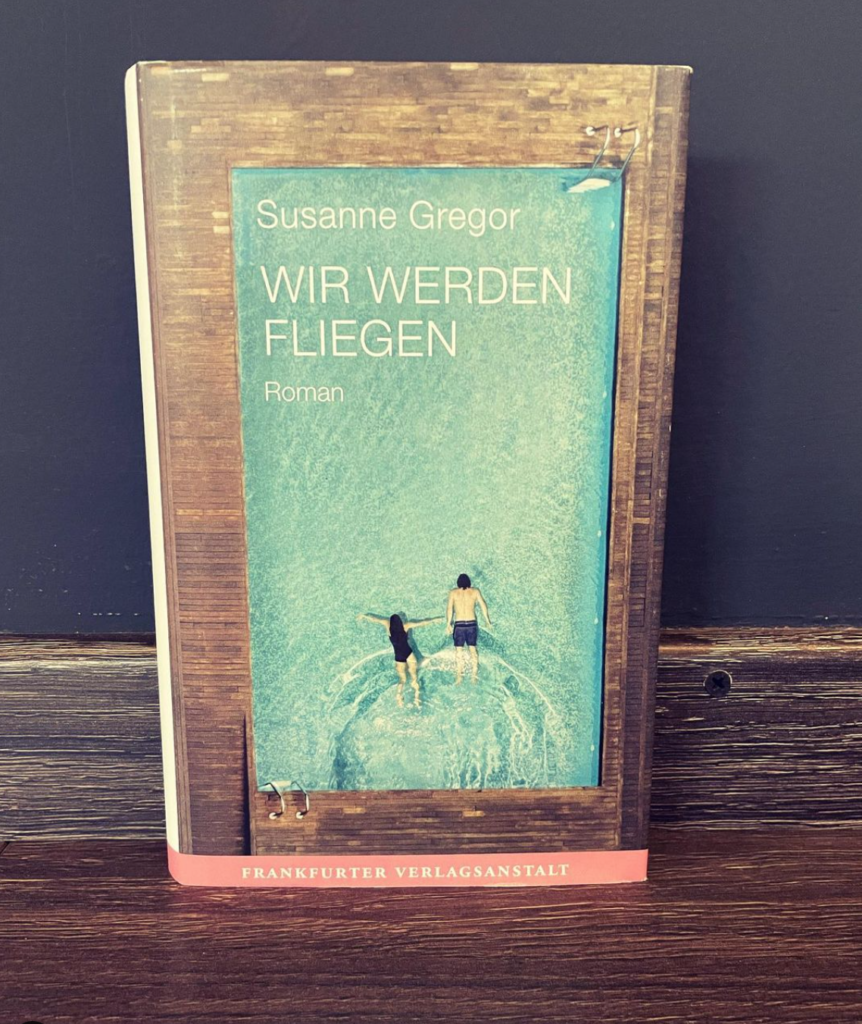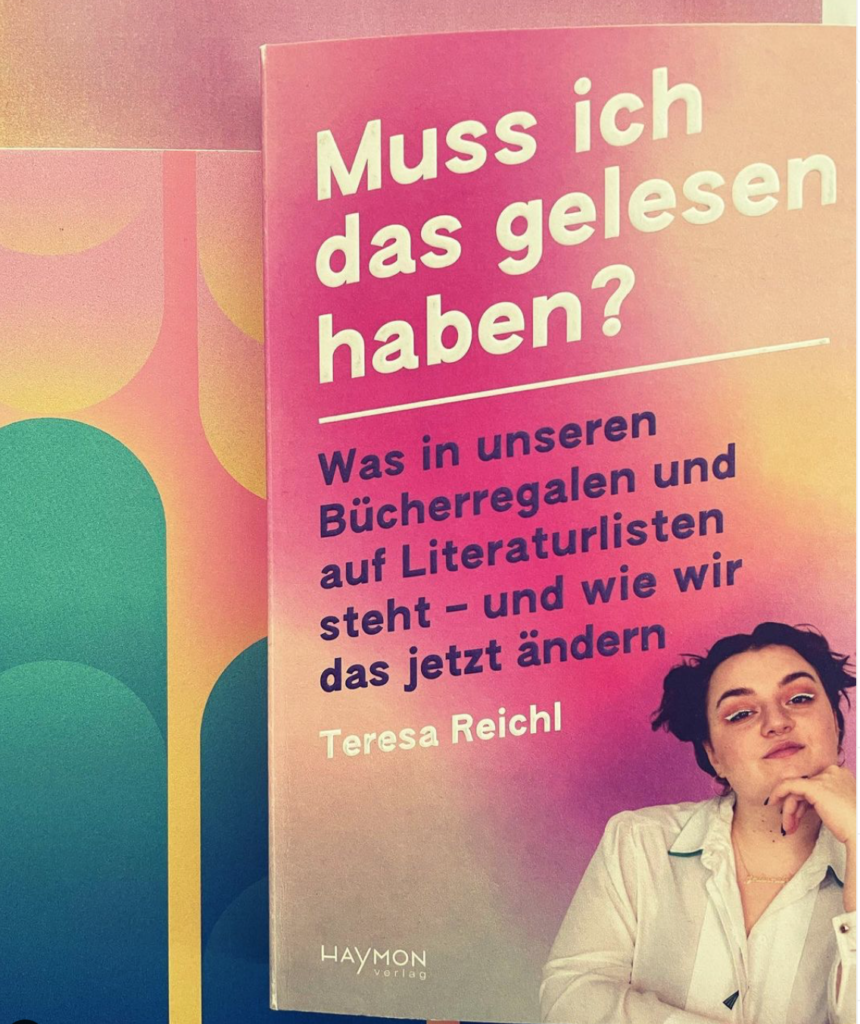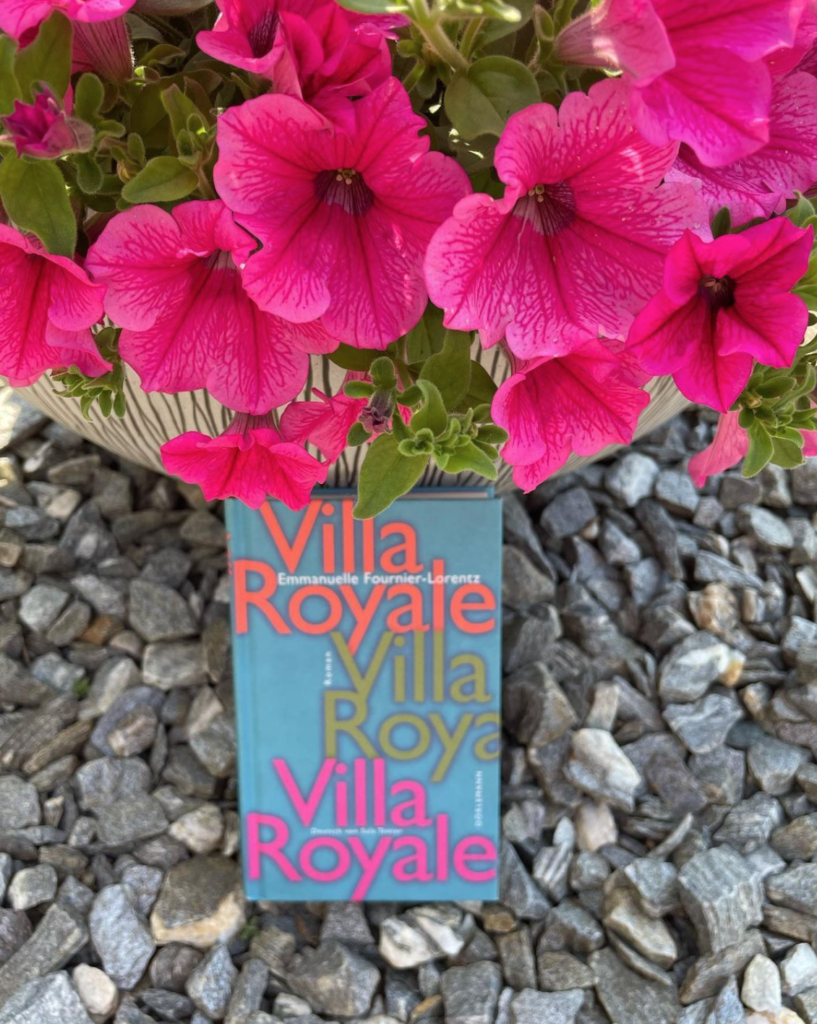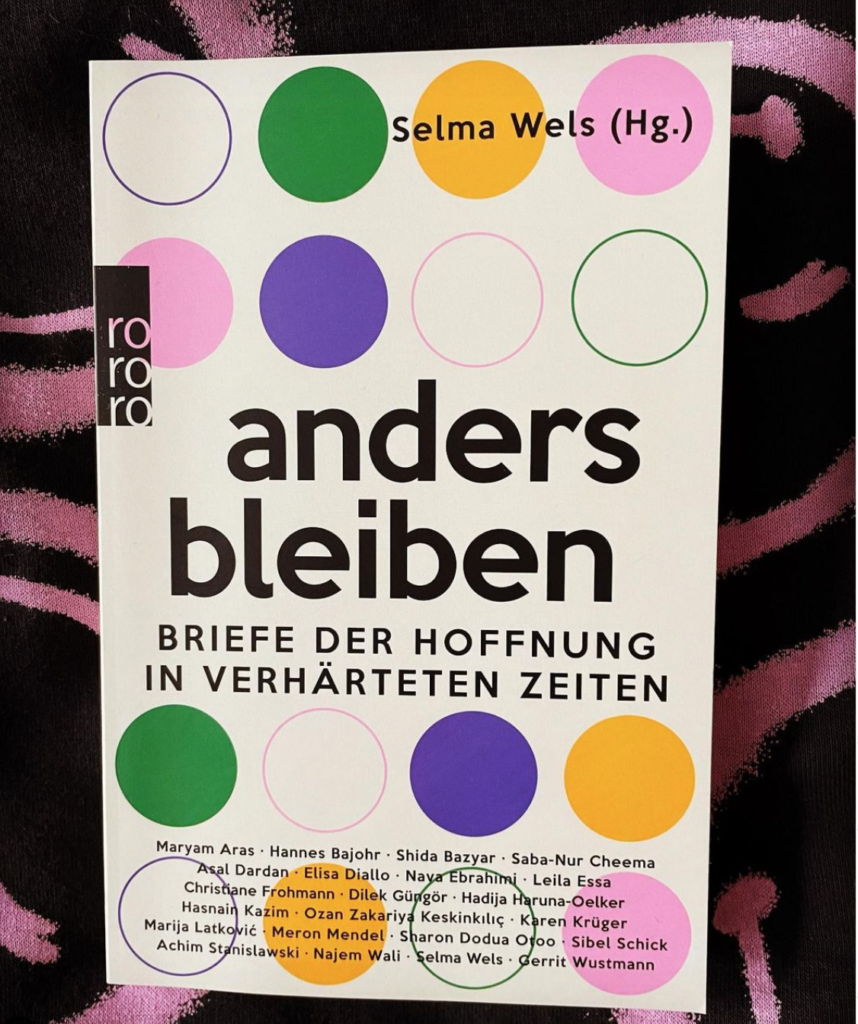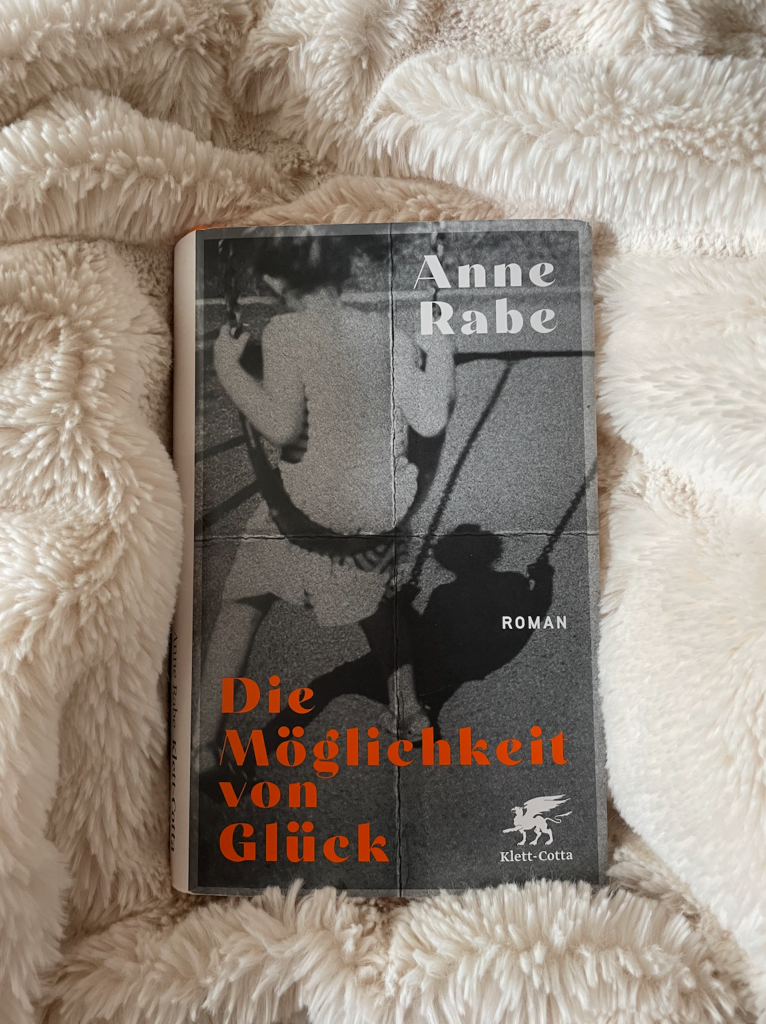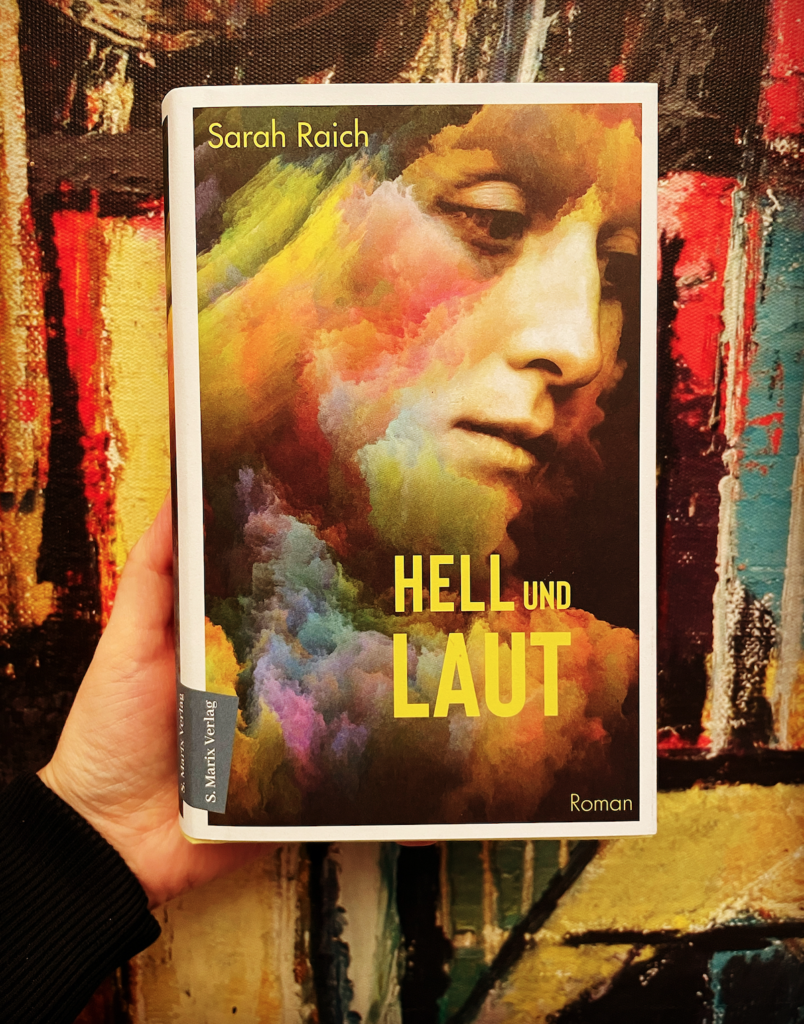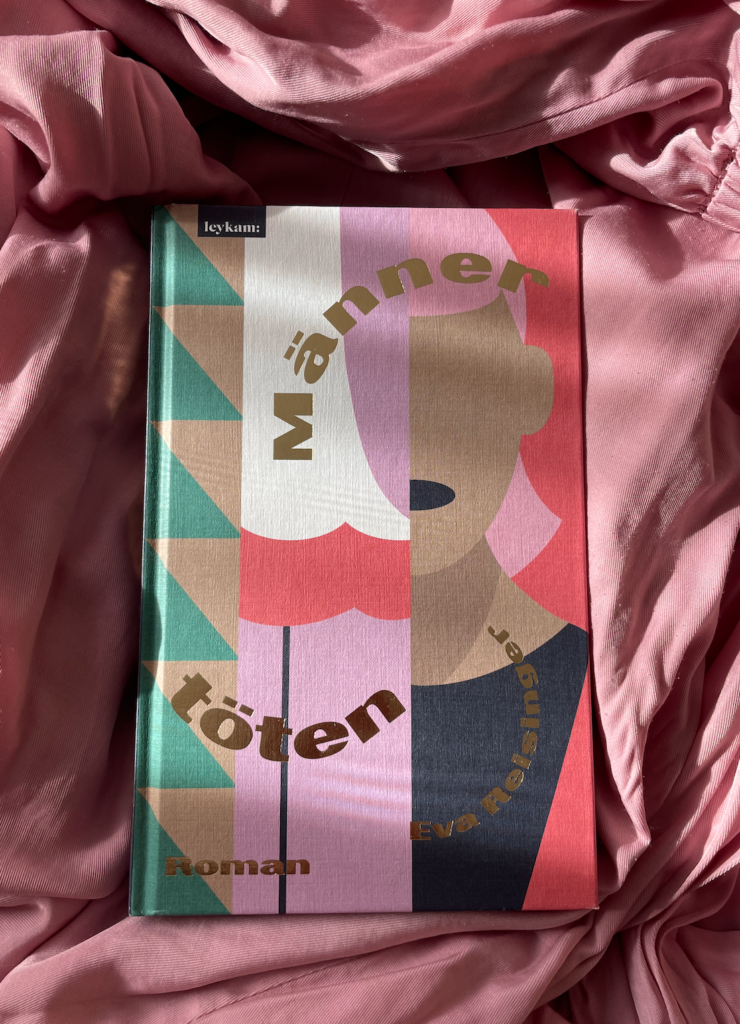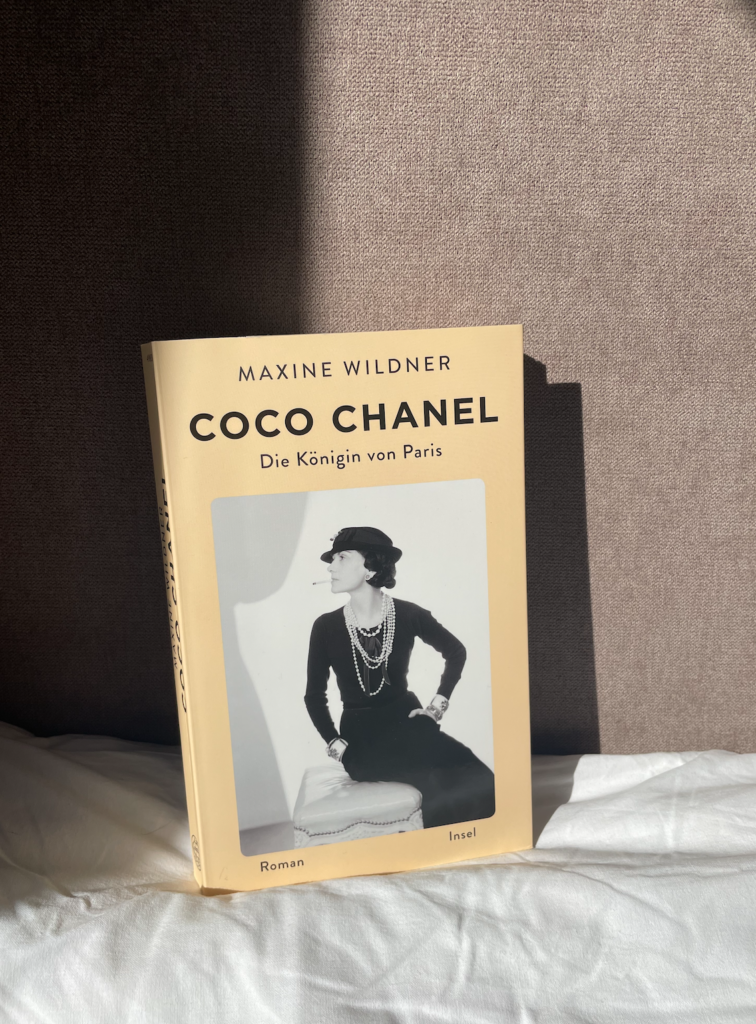„Ableismus steckt in allem, was unser Zusammenleben bestimmt“
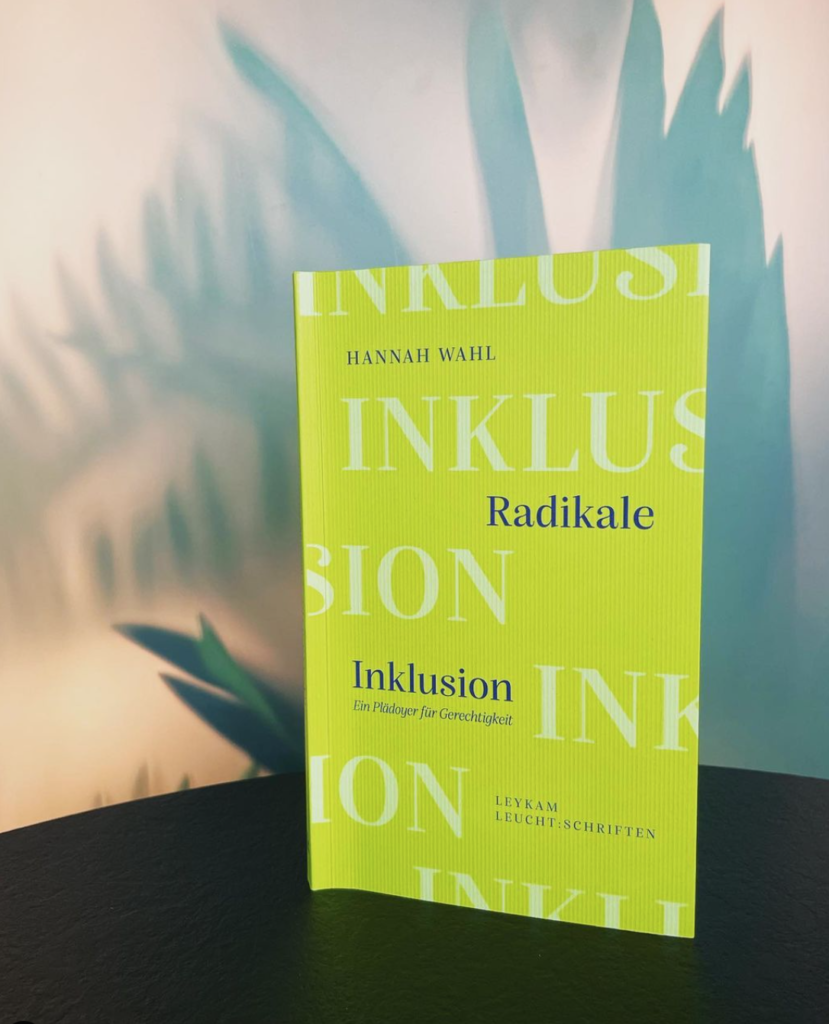
Aus gegebenem Anlass habe ich in letzter Zeit darüber nachgedacht, dass in manche Bücher so ein großes Marketingbudget gepumpt wird, und ihr wisst, was ich meine. Dass es bei diesen Büchern dann kein Wunder ist, wenn sie auf Platz eins der Bestsellerliste landen, und kein Zufall. Dass die Verantwortung dafür bei uns allen liegt, weil wir diese Inszenierungen mittragen. Davon können wir uns nicht reinwaschen, wir sind die Nachfrage. Und der Markt bedient uns, spiegelt uns. Aber was für eine Art Gesellschaft wollen wir sein? Was für ein Leben wollen wir führen? Eigentlich sollten Bücher wie dieses das größtmögliche Budget bekommen, sie sollten wändeweise in Buchhandlungen stehen, Platz im Feuilleton erhalten. Sie sollten gelesen werden, unbedingt.
Hannah Wahl arbeitet beim Unabhängigen Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Und dass es so einen Ausschuss gibt, macht deutlich, was wir sowieso wissen: dass diese Rechte nicht umgesetzt werden. Dass überhaupt nichts umgesetzt wird, was echte Inklusion bedeuten würde. Dies ist ein fulminantes, wütendes kleines Buch, das den Finger auf zahlreiche Wunden legt und unsere Scheinheiligkeit offenbart. Hannah Wahl stellt die Frage: Wie sehen Körper im Kapitalismus aus, wie sehen Körper aus, die dem Kapitalismus dienlich sind? Sie zeigt, wie weitreichend die Konsequenzen von Stigmatisierung sind. Und dass wir immer den betroffenen Menschen die Schuld geben statt dem System, das wir damit alle weiter unterstützen. Sie sagt so vieles, das wichtig ist und gehört werden muss. Teilhabe am Arbeitsleben, am Sozialleben, am öffentlichen Raum, an der Gesellschaft zu ermöglichen, ist unser aller Aufgabe. Und wir sollten sie endlich ernst nehmen.
„Allyship braucht politische, solidarische Substanz und muss an die Substanz der unterdrückten Verhältnisse gehen.“