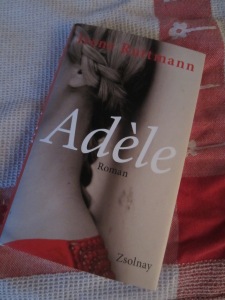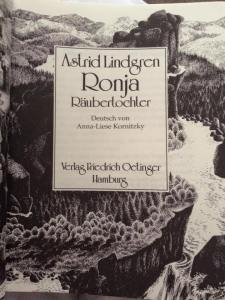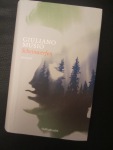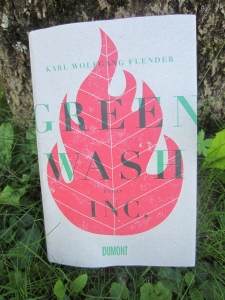 „Das verwackelte Handykamerabild ist die neue Ästhetik der Authentizität“
„Das verwackelte Handykamerabild ist die neue Ästhetik der Authentizität“
Thomas Hessel ist jung, skrupellos und ehrgeizig. Seinen Job als ehrlicher Journalist hat er an den Nagel gehängt, um für die Agentur Mars & Jung zu arbeiten. Sie sorgt dafür, dass ihre Klienten in der Öffentlichkeit gut dastehen, auch wenn sie ihre Shirts in Bangladesh von Kindern nähen lassen oder mit giftigem Elektromüll schmutzige Geschäfte machen. Thomas, der sich gegen seinen Konkurrenten Christoph profilieren will, um weiter nach oben zu kommen, beschreibt seine Tätigkeit so: „Wir machen Stakeholderanalyse, arbeiten Akten und Rechtslage durch, bereiten eine maßgeschneiderte Story vor, rekrutieren Testimonials, recherchieren Wissenschaftler, deren Erkenntnisse opportun sind. Faktenorientierte Krisenkommunikation ist das Stichwort.“ Und gefilmt wird mit der Handykamera für Youtube, weil den Hochglanzbildern keiner mehr glaubt. Unehrlichkeit siegt, und Thomas fühlt sich obenauf. Aber kann jemand, der einen Fake nach dem anderen produziert, noch an etwas Echtes glauben, an etwas Echtem festhalten? Hilflos muss er zuschauen, wie seine Beziehung den Bach runtergeht und seine beruflichen Träume sich zerschlagen. Denn wer anderen eine Grube gräbt, fällt manchmal in deren noch viel größere Grube …
Ich arbeite in der Werbung. Allerdings texte ich für Kunden, deren Produkte keine Lügen erfordern, Porsche, Skiny Underwear, Berger Schokolade, sondern nur gute Formulierungen und fetzige Ideen. Die Mechanismen hinter der fiktiven Agentur Mars & Jung sind mir aber freilich nicht fremd. Deshalb habe ich Greenwash, Inc. mit großem Amüsement bezüglich des Arbeitsalltags, der Eitelkeiten und der Machtspielchen gelesen. Aber auch mit ebenso großem Entsetzen angesichts der skrupellosen PR-Maschinerie, für die ein Menschenleben nichts zählt. Außer natürlich, es taugt für eine gute Geschichte. Der junge deutsche Autor Karl Wolfgang Flender hat nicht nur Literarisches Schreiben studiert, sondern auch Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation. Er hat also von beidem Ahnung: dem, worüber er in Greenwash, Inc. schreibt – und wie er es macht. Beides ist ihm gelungen, sein Roman hat mich sofort mitgerissen und ich konnte ihn – im Freibad, mit den Kindern! – nicht mehr weglegen. Abends hatte ich ihn fertig inhaliert.
Ich mag böse, zynische Geschichten. Und da ich generell an starkem Menschheitshass laboriere und uns für den schlimmsten Parasiten halte, den sich die Erde je eingefangen hat, hat diese hier mir besonders gut gefallen. Weil sie zeigt, wie unfassbar dumm, gierig und seelenlos der Mensch ist. Ebenso gut fand ich – wie passend – die dazugehörige PR-Aktion des Dumont Verlags, der Postkarten und einen Shoppingbeutel mit den krassesten Sagern des Buchs verschickt hat. Well done! Thomas ist als Protagonist eine ganz merkwürdige Mischung aus Held und Antiheld. Einerseits forsch und aufstrebend, ist er in anderen Belangen – vor allem bei seiner Freundin – ein totaler Waschlappen. Seine innere Unsicherheit kaschiert er durch ein arrogantes Auftreten – ein Klassiker. Wie ihm dann alles um die Ohren fliegt, ist nicht immer glaubwürdig, aber dennoch unterhaltsam. Er macht keine Entwicklung durch, bleibt am Ende so unwissend und statussymbolsüchtig wie zuvor, eine Marionette, die nichts begriffen hat. Und das erscheint mir durchaus realistisch. Ich habe von diesem Roman nicht erwartet, dass er die Welt bzw. meine Weltsicht verändert oder mir Lösungsansätze aufzeigt, sondern nur, dass er mir ein paar kurzweilige Stunden bereitet, und damit war ich hochauf zufrieden. Freilich kann man dem Buch ankreiden, dass es letztlich wahnsinnig flach bleibt, doch auch das scheint mir passend: Weil alles, worum es in Greenwash, Inc. geht, Schall und Rauch ist. Zu hoffen bliebe, die dargestellten Methoden seien nur Fiktion, doch das ist natürlich naives Denken. Bestimmt sind die heraufbeschworenen und beschriebenen Szenarien längst Realität. Ein Grund mehr, diesem Buch viele Leser zu wünschen.
Greenwash, Inc. von Karl Wolfgang Flender ist erschienen im Dumont Verlag (ISBN 978-3-8321-9764-3, 392 Seiten, 19,99 Euro). Die Meinungen zum Buch gehen auseinander: Während es zum Teil große Kritik einstecken musste, gibt es auch begeisterte Stimmen. Buchrevier zeigte sich beispielsweise angetan, Brasch & Buch dagegen enttäuscht.