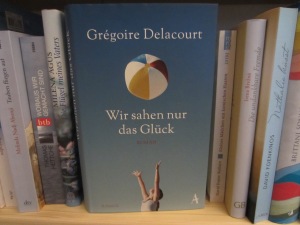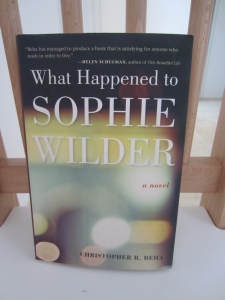Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln
Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln
Gustava weiß nicht, wer ihr Vater ist, weil sie ihrer Mutter dieses Geheimnis nie entlocken konnte. Schon gar nicht am Ende, als die Mutter zusehends den Verstand verlor – und angewiesen war auf die Pflege ihrer Tochter, die gerade dabei gewesen wäre, am Theater als Schauspielerin Karriere zu machen. Nach dem Tod der Mutter kann Gustava wegen der jahrelangen Pause nicht mehr an ihre ersten Erfolge anknüpfen und zieht erst einmal von Wien nach Berlin, wo sie sich um eine Agentin bemüht. Zudem lernt sie den Psychiater Donald Gliese kennen – ebenso dick wie merkwürdig –, der viel mehr Raum in ihrem Leben einnimmt, als es für einen Therapeuten üblich ist. Und um den Gärtner Nello entspinnt sich eine reichlich komplizierte Familiengeschichte, die Gustava fasziniert und von ihrer Einsamkeit ablenkt.
Die österreichische Autorin Ivana Jeissing hat ihrem Roman Wintersonnen ein sehr klassisches Setting zugrundegelegt: Eine junge Frau, die ihren Vater nicht kennt, lüftet nach dem Tod der Mutter endlich das Familiengeheimnis. So weit, so bekannt. Wer der Vater ist, ist eigentlich irrelevant – und birgt auch in diesem Fall keine großen Überraschungen. Was ich an Wintersonnen sehr mag, das sind der angenehme, leicht lakonische Ton und die zeitweise recht eleganten Metaphern. Was ich jedoch nicht sehr mag, ist das Ausgefranste, Verrückte und Undurchsichtige, das vor allem durch die beiden Nebenfiguren Gliese und Nello in die Geschichte kommt. Der Therapeut hat, vereinfacht gesagt, offenbar einen an der Waffel, drängt Gustava einen Pudel auf, der ihm gar nicht gehört, steht unangemeldet vor ihrer Tür – reißt sie mit seinen ungewöhnlichen Methoden aber auch aus ihrer Lethargie und sorgt für amüsante Lesemomente.
Bei der Story rund um Nello dagegen verliere ich, ich gestehe es, zwischendrin ganz einfach den Überblick. Und was hat das alles eigentlich miteinander zu tun? Irgendwie nichts, aber dank der Macht des Zufalls auch wieder alles. Gustava ist eine ebenso sympathische wie blasse Protagonistin, die zwar den Hauptteil der Geschichte trägt, sie aber dennoch kaum vorantreibt, weil sie so fremdbestimmt lebt. Am Ende fügt sich alles derart gut, wie es im echten Leben nie möglich wäre. Über die Maßen begeistert hat Wintersonnen mit nicht, dazu ist es zu weich und zu lasch und zu lieb. Aber es ist das, was man im Englischen „a good read“ nennt.
Wintersonnen von Ivana Jeissing ist erschienen im Metrolit Verlag (ISBN 978-3-8493-0371-6, 234 Seiten, 22 Euro).