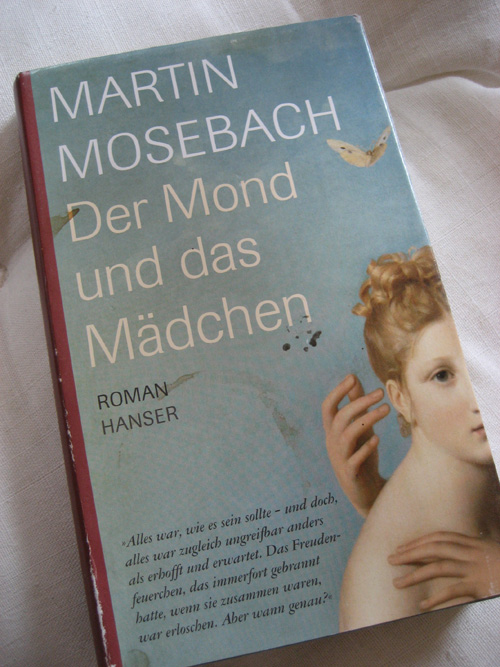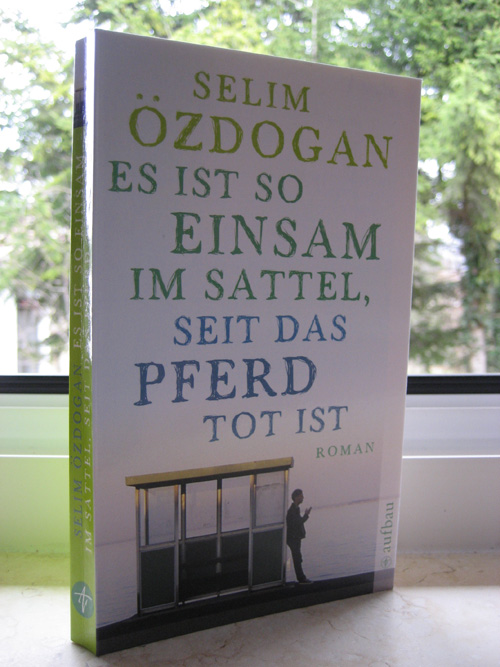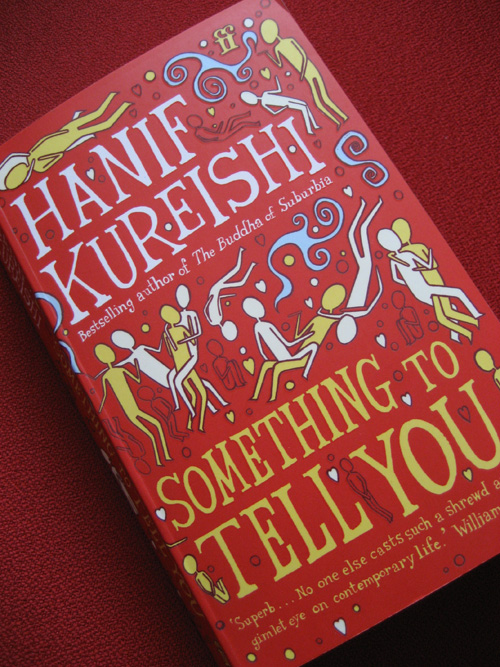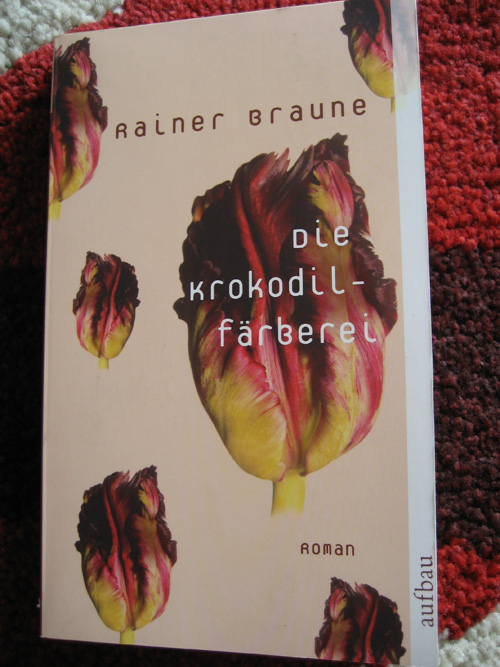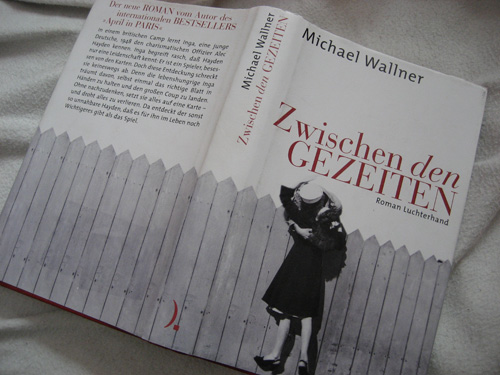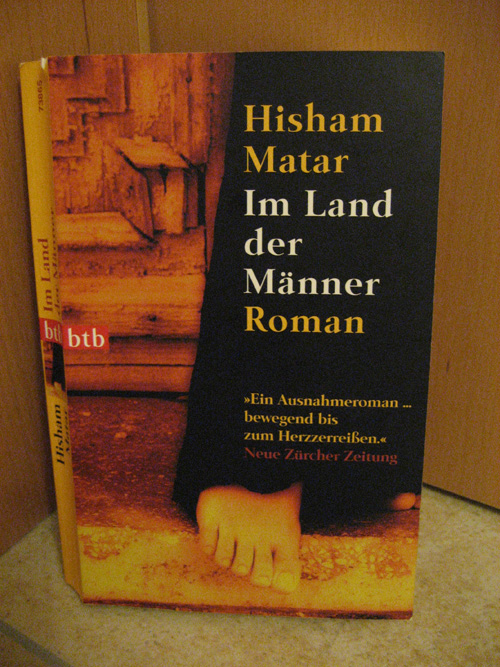 Ein Junge im Land der Männer
Ein Junge im Land der Männer
Suleiman ist 9 Jahre alt. Er lebt in Libyen, und wir schreiben das Jahr 1979. Muammar el-Gaddafi, “Führer der libyschen Volksrevolution”, ergreift die Macht. Und das ist für alle, die anderer Gesinnung sind, gefährlich – darunter Suleimans Vater. Ihrer beider Beziehung ist jedoch nicht so eng wie Suleimans Bindung an seine Mutter. Sie wurde mit nur 14 Jahren an einen wesentlich älteren Mann verheiratet, ihre Wünsche zählen nichts in Libyen. Der Titel des Buchs bringt ihre Lage auf den Punkt. Und während sie sich diesem Schicksal tagsüber fügen muss, gibt es viele Nächte – wenn Suleimans Vater auf Geschäftsreise ist -, in denen sie nicht schweigen kann. Dann nimmt sie ihre “Medizin” und erzählt Suleiman Geheimnisse, die ihm auf der Seele liegen und die er für sich behalten muss. Doch Suleiman ist zu jung für das, was rund um ihn geschieht: Er versteht es nicht. Die Erwachsenen erklären ihm nichts, und so verhält sich Suleiman naiv und bringt seine Familie unbeabsichtigt in Gefahr.
Im Land der Männer ist ein politisch angehauchter Roman, der die Hilflosigkeit der Frauen und die potenzielle Gefahr für Andersdenkende im Libyen der 1980er-Jahre beschreibt. Schwierig daran ist, dass man sich ein wenig in der hiesigen Geschichte auskennen muss, um der Handlung folgen zu können: Denn der Leser folgt der Hauptperson Suleiman, und der ist nicht informiert. Vielmehr stolpert er orientierungslos durch die Ereignisse – und ich rätsle mit ihm mit. Das ist stellenweise anstrengend und verwirrend. Zumindest aber ist es glaubwürdig – denn Hisham Matar hat sich nun einmal für die Erzählperspektive eines kleinen Jungen entschieden und bleibt konsequent. In manchen Einschüben erkennt man aber, dass Suleiman die Geschichte viele Jahre später erzählt und hier eigentlich kein Kind spricht. Da hätte er vielleicht doch aus der Ferne eingreifen und ab und zu etwas erklären können. Grundsätzlich aber trifft Hisham Matar den Ton, den ein solcher Roman braucht: kindlich, erschrocken, traurig und voller Angst. Das Ende ist schlüssig, allerdings nicht herausragend. Alles in allem angenehm zu lesen, informativ, stilistisch solide und eine leise Anklage gegen ein totalitäres System.