 „Zuneigung ist etwas Vergängliches“
„Zuneigung ist etwas Vergängliches“
Ein Schiff läuft aus, ein Walfangschiff, und an Bord sind Männer, die hart und rau sind wie die See, zu der sie fahren. Und wenn jemand keine Skrupel hat, Tiere zu töten, Robben zu erschlagen, dass das Blut nur so spritzt, einen Wal zu jagen, dieses große, sanfte, wunderschöne Wesen, wie ist es dann in Bezug auf Menschen? Hält ihn dann etwas davon ab, auch einen Menschen umzubringen, ist da noch eine Hemmschwelle? Henry Drax ist Harpunierer, ein undurchsichtiger Mann, der nicht viel redet. Patrick Sumner ist Arzt, und die Geschichten, die er über seine Vergangenheit erzählt, sind wohl nicht wahr. Zwischen diesen beiden Männern entspinnt sich ein Konflikt, der seinen Höhepunkt in einem Verbrechen findet, das auf dem Schiff geschieht. Auf dem Schiff, das sich mitten in der Kälte befindet, in einer unwirtlichen Gegend, auf Expedition zum Töten von Tieren – aber auch ein Mensch kommt dort schnell um.
„Dieses Buch ist so krass“, haben sie gesagt, „fast schon grenzwertig.“ Und ich hab mir gedacht: Aha, aha, mal sehen, da bin ich ja gespannt. Und dann les ich es und es ist wirklich krass und es ist wirklich grenzwertig, aber es ist auch so gut. In Nordwasser bedient Ian McGuire sich einer Sprache, die so ist wie seine Männer: schonungslos, rau, direkt, ohne Poesie. Er beschreibt die Ereignisse so nüchtern, so klar, dass ich das Gefühl habe, ich stehe daneben, ich bekomme das unmittelbar mit, ich sehe das vor mir. Und es ist nichts Schönes, was ich da sehe, im Gegenteil, es sind schreiende, verendende Tiere, es sind Menschen, die einander hintergehen und verraten, es ist Dreck und Blut und das unerbittliche Meer. Es riecht nach Schweiß und Kotze, nach ungewaschenen Körpern, nach Angst.
Natürlich kommen ihm die Lügen mühelos über die Lippen. Worte sind nur Geräusche in einer bestimmten Reihenfolge, und er kann sie gebrauchen, wie es ihm gefällt. Schweine grunzen, Enten quaken, Menschen lügen, so läuft das für gewöhnlich.
Ich mag Bücher, die am Meer und auf dem Meer spielen. Ich mag es wild und schnörkellos, am liebsten mitten ins Gesicht. So ist dieses Buch. Es erinnert mich in seiner Ausweglosigkeit an Ins Westeis von Tor Even Svanes, über das ich geschrieben habe: Habt ihr schon mal ein Buch gelesen, das von der ersten bis zur letzten Seite aus Beklemmung bestand – in Worte gegossen? Dasselbe könnte man über Nordwasser sagen, weil man ja schon weiß, dass da nichts Gutes kommen kann, dass die Ausgangssituation – Männer ohne Gewissen zusammengepfercht auf einem Schiff, von dem niemand flüchten kann – geradezu danach schreit, dass etwas Grausames geschieht, weil das alles beklemmend ist, und dann ist man trotzdem überrascht. Was da geschieht. Und wie grausam es ist. „Dieses Buch ist so krass“, möchte ich euch sagen, „fast schon grenzwertig.“ Lest es, lest es unbedingt!
Nordwasser von Ian McGuire ist erschienen im mare Verlag (ISBN 978-3-86648-267-8, 304 Seiten, 22 Euro).
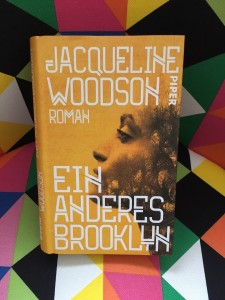 „Ich fing an, sie zu hassen. Ich fing an, sie zu lieben“
„Ich fing an, sie zu hassen. Ich fing an, sie zu lieben“ „Ich mag dich zu sehr, sagte ich, ungeschickt, aber aufrichtig, und es tut mir nicht gut, dich so sehr zu mögen“
„Ich mag dich zu sehr, sagte ich, ungeschickt, aber aufrichtig, und es tut mir nicht gut, dich so sehr zu mögen“ „Ich spüre mich nicht. Ich spüre meine Grenzen nicht. Ich weiß nicht, wo ich aufhöre“
„Ich spüre mich nicht. Ich spüre meine Grenzen nicht. Ich weiß nicht, wo ich aufhöre“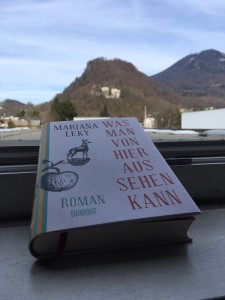
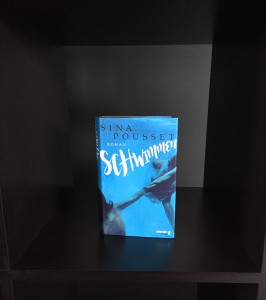 „Es ist das Einzige, das sie nicht verhandeln können: die Realität. Sie leben, er ist tot“
„Es ist das Einzige, das sie nicht verhandeln können: die Realität. Sie leben, er ist tot“ „Der Krieg findet für uns Feinde, ohne dass wir ihn darum gebeten haben“
„Der Krieg findet für uns Feinde, ohne dass wir ihn darum gebeten haben“ „Es ist unser Dorf, wir haben kein anderes“
„Es ist unser Dorf, wir haben kein anderes“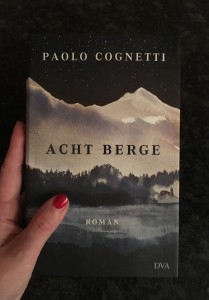 „Wenn einer in die Berge geht, dann weil man ihn im Tal nicht in Frieden lässt“
„Wenn einer in die Berge geht, dann weil man ihn im Tal nicht in Frieden lässt“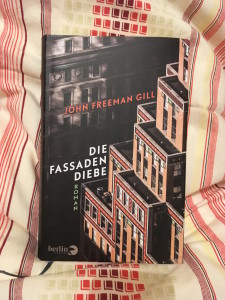 „Väter gingen fort, gelegentlich auch Mütter. Häuser hatten dazubleiben“
„Väter gingen fort, gelegentlich auch Mütter. Häuser hatten dazubleiben“