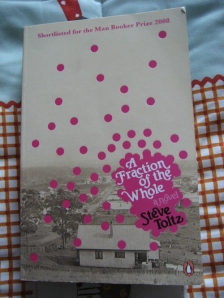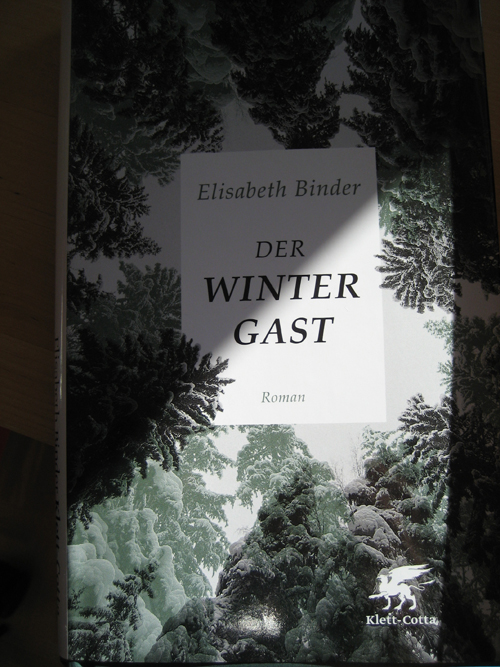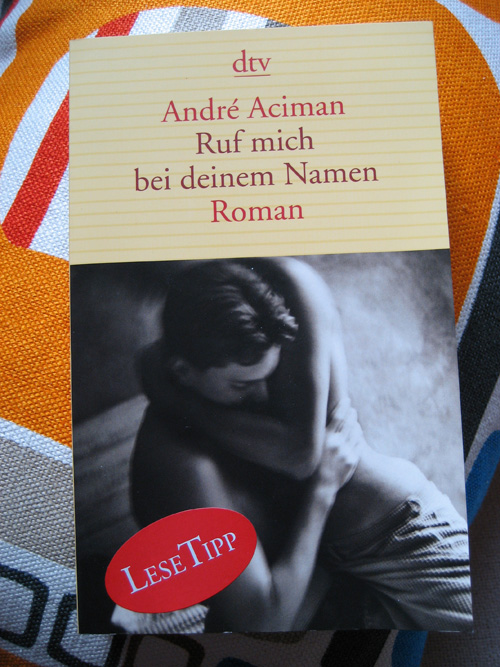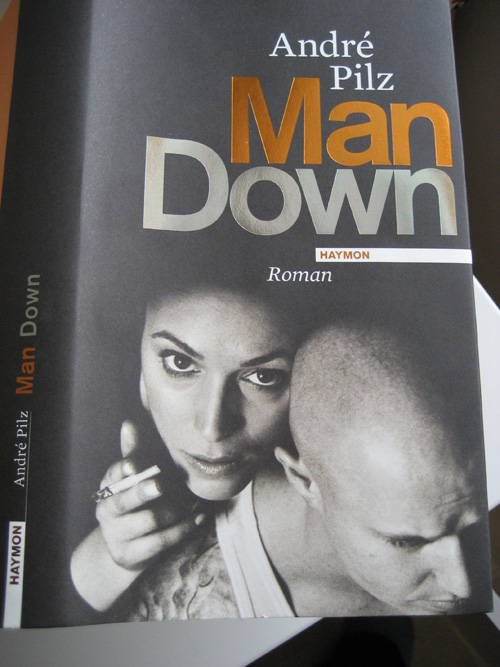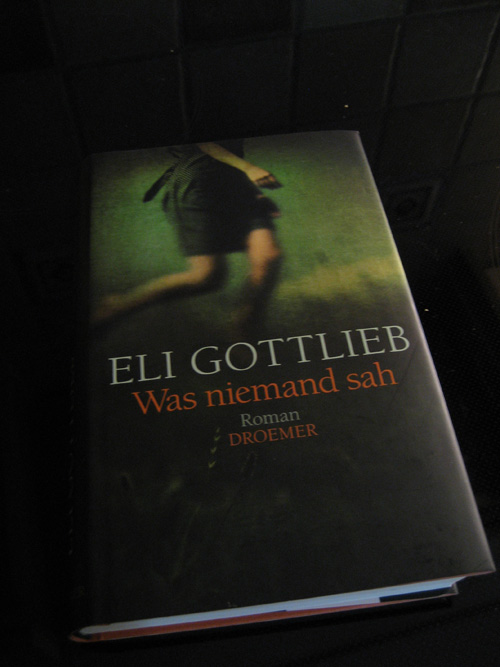Irrwitzige Geschichten aus dem polnischen Plattenbau
Irrwitzige Geschichten aus dem polnischen Plattenbau
“An zwei Orten wurde der Andrang immer größer: in der Kirche und vor Jericho, dem Schnapsladen. Aber viele fingen auch an, sich aufzuhängen. Und alles nur wegen der Arbeitslosigkeit!” In einer polnischen Plattenbausiedlung dominieren Beton, Gewalt und Langeweile. Um wenigstens ein bisschen Sinn in ihrem Dasein zu sehen, müssen die Bewohner tief in der Fantasiekiste kramen: Der Ich-Erzähler schmückt das Leben der bekanntesten Siedlungsgestalten zu Heiligenlegenden aus. In kurzen Episoden berichtet er, aus welchem Grund sie jeweils zu Heiligen wurden – was in den meisten Fällen natürlich den vorangegangenen Tod der Leute bedingt. Da gibt es etwa den heiligen Haidegger, der sich um die ungeliebten und vergessenen Wörter kümmerte, oder den heiligen Kyrill, der gratis für alle starb, die gerade selbst keine Zeit hatten. Der heilige Egon dagegen sorgte dafür, dass jede einzelne Fernsehsendung in den Himmel kam, doch: “>Ach herrje!<, stöhnte Sankt Egon, >die Werbung! Ich habe die Werbung vergessen! Die Ärmste, wer wird sich jetzt um sie kümmern, wer für sie um Vergebung bitten?< >Zum Teufel mit der Werbung<, brummte Sankt Peter. Und so kam die Werbung in die Hölle.”
Klingt verrückt? Ist es auch. Man kann Die Vorstadtheiligen nicht einmal ansatzweise mit normalen Maßstäben beurteilen. Dieses Buch zu lesen, ist wie durch einen Zoo voller nie gesehener Fabelwesen zu spazieren: Jedes Kapitel wartet mit dermaßen schrägen Einfällen auf, dass man aus dem Staunen und aus dem Kopfschütteln nicht mehr herauskommt. Über manche kuriose Begebenheit in diesem ungewöhnlichen Roman amüsiere ich mich gar königlich: “Wir waren alle kugelrund. Auf der einen Seite hatten wir einen Zipfel, auf der anderen ein Loch, und so kullerten wir von früh bis spät durch die Siedlung. Das Schicksal gab dir mit seinem Queue einen Stoß, Mann, und du wusstest nie, auf wen du knalltest. Dem Pfarrer gefiel das überhaupt nicht.” Eine große Rolle in Lidia Amejkos Sammlung moderner Heiligengeschichten spielt natürlich Gott: Er hat die Siedlung aus einem achtlos hingeworfenen Batzen Beton geschaffen, und mit ihm bekommen es alle Heiligen eines Tages zu tun. Im Leben müssen sie allerdings ohne seine Hilfe auskommen.
Lidia Amejko hat eine wilde Mixtur angerührt aus irdischer Trostlosigkeit und alltäglichen Problemen, angereichert mit viel Alkohol und gewürzt mit einem kräftigen Schuss Metaphysik. Ihre Geschichten sind kluge Allegorien, groß angelegte, geniale Metaphern – manche davon leicht zu entschlüsseln, andere höchst undurchsichtig. Es gibt Abschnitte in diesem Buch, die ich nicht im Geringsten verstehe, andere sind sehr erheiternd. Lidia Amejko wagt sich auch an eine Art Metasprache, stellt die Wörter wie handelnde Personen in die Welt, und wer einen Eindruck von der Genialität dieses Romans gewinnen möchte, nimmt es in der Buchhandlung in die Hand und schlägt Seite 64 auf, wo es um die obdachlosen Wörter geht. Die Vorstadtheiligen ist alles andere als leichte Kost. Die Charaktere sind bewusst extrem überzeichnet, der Inhalt kippt immer wieder ins Surreale. Dafür aber garantiert dieses Buch ein Leseerlebnis, das man im Gegensatz zu den vielen öden 08/15-Romanen nicht so schnell vergisst. Der Ideenreichtum der Autorin ist beeindruckend, ihre Formulierungen sind wunderbar und auf den Punkt gebracht: “Am Küchentisch schoben sie sich gegenseitig die Stille zu, hielten sich ihre Seufzer unter die Nase und ließen ihre Hände wie leere Teller über das Wachstuch wandern” zum Beispiel oder: “Irgendwann später wurde die Nacht klein und fest, wie ein Stück Schokolade, das am Ende des Tages auf seinem Kopfkissen lag.” Respekt! Dieser Roman ist völlig verquer, absurd, sehr originell, gleichzeitig amüsant und verstörend. Bemerkenswert finde ich auch das wirklich gelungene Cover. Die Vorstadtheiligen ist sicher keine einfache Unterhaltungslektüre – aber ein lesenswertes Abenteuer!
Die Vorstadtheiligen ist erschienen im Dumont Buchverlag (ISBN 9783832195526, 18,95 Euro).