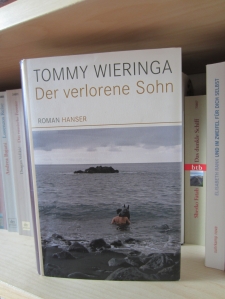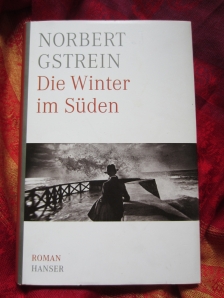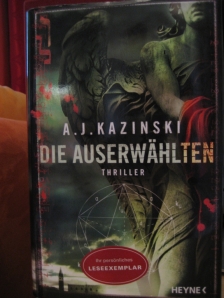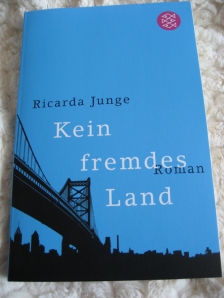„Jeder Gast bekommt bei seinem Besuch eine Geschichte geschenkt“
„Jeder Gast bekommt bei seinem Besuch eine Geschichte geschenkt“
Helene und Lena: Zwei Frauen, die es aus unterschiedlichen Gründen in ein kleines Dorf an der spanischen Nordwestküste verschlägt. Helene hat hier einst schöne Momente verbracht und weiß nach einem schweren Schicksalsschlag keinen Ort, an den sie sonst gehen könnte. Sie wird von der Klosterschwester Hermana Consuelo liebevoll umsorgt und gepflegt. Lena ist erst 18 und liegt mit der ganzen Welt im Clinch, weil niemand sie versteht und keiner sie liebt. Die spießigen Eltern hatten genug von Lenas Rebellion und schickten sie zum Onkel, wo sie die Kinder hüten soll. Wie alle Dorfbewohner wird Lena aufmerksam auf die stumme verzweifelte Frau, die jeden Tag ruhelos am Strand entlangrennt, um dann zusammenzubrechen und lethargisch aufs Meer zu starren: Helene. Sie will Helenes Geheimnis ergründen und nähert sich ihr an. In ihrer Jugendlichen Großkotzigkeit geht sie beim Herumstöbern in Helenes Vergangenheit nicht gerade feinfühlig vor – und bringt sich schließlich selbst in die Bredouille …
Es gibt Bücher, die machen es mir schwer. Sie zeigen mir Seiten, die mir außerordentlich gut gefallen, und enthalten Sätze, bei denen ich zustimmend nicken mag. Gleichzeitig sind sie aber stellenweise so anstrengend, langweilig und bescheuert, dass ich nicht weiterlesen will. Vom Leben und Sterben der Pinguinfische von Juliane Hielscher ist so ein Buch. Das Setting ist schön, das Meer rauscht, die Menschen in dem spanischen Dorf tragen ihre Geschichten im Herzen und auf der Zunge. Zwei Frauen treffen hier aufeinander, die verschieden sind, aber sich selbst im Schmerz der anderen erkennen. Wobei Helene viel authentischer wirkt als Lena, die mit ihrer Bockigkeit und ihrem Selbsthass ein richtig blödes Gör ist. Ihre Art, mit Helenes Traurigkeit umzugehen, ist unerträglich, und weil ich dauernd lesen muss, dass sie dumme Dinge sagt wie: „Die hat doch so ein Trauma wegen dieses Kindes. Die kapiert doch gar nicht, was mit ihr los ist“, würde ich das Buch am liebsten in die Ecke pfeffern. Aber dann wieder hält mich ein schöner Gedanke, ein guter Satz bei der Stange und ich breche das Buch nicht ab (wer mich kennt, weiß, dass ich ja generell ein Problem damit habe). Hätte ich es mal lieber gemacht. Denn natürlich ist ein Roman, der mich nicht gleich überzeugt, fast immer Zeitverschwendung – das hat mich meine lange Leseerfahrung gelehrt. Und als dann das dicke Ende kommt, ist es dermaßen überzogen und unbegreiflich, dass … ich gar nicht mehr darüber reden mag.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: ein uninteressantes Buch, aber ein wahnsinnig tolles Cover – das bisher schönste 2012. Wenn man den Schutzumschlag entfernt, ist man am Meer.
… fürs Hirn: für mich nur die Qual, das Buch schlecht, aber nicht schlecht genug zu finden.
… fürs Herz: Helenes großer, sehr trauriger Verlust.
… fürs Gedächtnis: endlich zu lernen, Bücher abzubrechen.