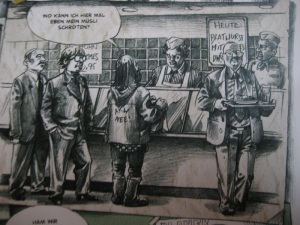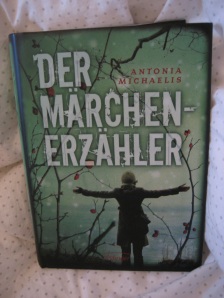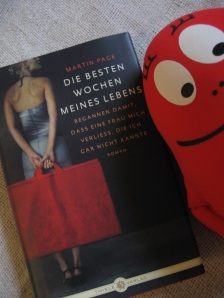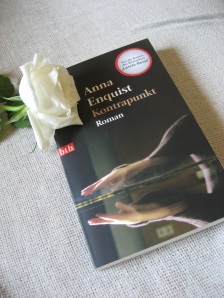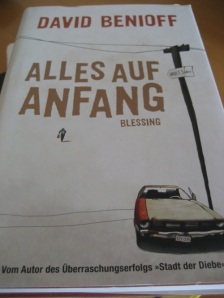“Immer habe ich nah bei Felix gestanden, aber der Fokus war stets auf ihn gerichtet”
“Immer habe ich nah bei Felix gestanden, aber der Fokus war stets auf ihn gerichtet”
“Ich habe mich so lange nicht gemeldet, dass Jakob sich nach mir erkundigt hat. Manchmal ist er wie eine Tante, die nur das Beste will, dabei antiquiert wirkt und fehl am Platze. Seine Sätze werden dann linkisch wie bei anderen Menschen die Bewegungen.” Diese Zeilen liest Jakob im Tagebuch seines Freundes Felix – und sie offenbaren ihm mehr, als er wissen sollte. Felix ist verschwunden, einfach so, ohne Ankündigung, ohne Erklärung, während des Biertrinkens in der Kneipe. Jakob ist verwirrt, verunsichert, kann das Fortgehen seines Freundes aus Kindertagen nicht akzeptieren. Er schleicht sich über Felix’ Exfreundin, die robuste, dicke Manja, in dessen Wohnung ein, stöbert in Felix’ privatestem Besitz, setzt sogar seine Beziehung zu Sara aufs Spiel, die seiner Obsession nichts abgewinnen kann – und verliert sich selbst völlig in seiner Suche nach Felix’ Spuren.
“Ich werde mich konzentrieren müssen, um die Kontrolle zu behalten, sie wiederzuerlangen, wenn ich sie schon verloren habe. Ich werde lesen, von Felix, und an einem Punkt werde ich vielleicht begreifen, dass es nichts zu verstehen gibt. Dann werde ich es hoffentlich gut sein lassen.” Zwei Ich-Erzähler gibt es in Hannes Köhlers melancholischem Buch In Spuren, zwei Freunde, die – bei genauerem Hinschauen – vielleicht gar keine waren. Felix, der sich aus dem Staub gemacht hat, ist nicht anwesend im Roman, seine Stimme hören wir aus seinem Tagebuch, ihn sehen wir durch die Augen von Jakob, der bei seinen Nachforschungen so viel Neues über Felix erfährt, dass er das Gefühl bekommt, ihn gar nicht gekannt zu haben. Weil er blind war für die wahre Persönlichkeit von Felix oder weil dieser sie ihm bewusst verheimlicht, sich ihm nie richtig gezeigt hat? Das ist die Basis dieses Buchs, eine Frage, die uns mit Sicherheit alle in so mancher rätselhaften Stunde verfolgt: Was wissen wir wirklich über die, die wir lieben? Und was geschähe, wenn wir alles erführen?
Zwei junge Männer sind Hannes Köhlers Protagonisten, entspannt, fröhlich, fertig mit dem Studium und halb im Arbeitsleben, befreundet und vermeintlich sorglos. Erst als Felix nicht mehr da ist, sieht Jakob ihn wirklich, liest von seinen Ängsten und Neurosen, seiner Gewalttätigkeit, seinen Gedanken an Flucht. Beklemmend authentisch beschreibt der junge deutsche Autor, wie Jakob sich einnistet in Felix’ Fehlen, wie ihm mit Felix’ Fortgang auch ein Stück von sich selbst abhandenkommt, er findet abgedrehte, ausdrucksstarte Worte für all das, was die Freunde einander nie gesagt haben. In Spuren ist ein fragmentarischer, lyrischer Roman über das Rätsel der Freundschaft, ein einziger Fluss ohne Kapitel, ein verschlingender Strom, in dem man versinken kann und muss. Die Klappentexterin hat mich aufmerksam gemacht auf dieses leuchtende, interessante Buch, das so vielseitig und stellenweise nebelverhangen ist wie die Stadt Berlin, in der es spielt. Sie hat auch ein lesenswertes Interview mit Hannes Köhler geführt, in dem er über das Wesen der Freundschaft spricht und über die Idee zu diesem kraftvollen Roman, den der kleine mairisch Verlag – IndieVerlag für junge Literatur lautet dessen Eigenbezeichnung – publiziert hat.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: ein helles, verschwommenes, fast schon in Luft aufgelöstes Cover, das mir erst den Eindruck vermittelt hat, der Roman spiele auf dem Land.
… fürs Hirn: die Frage, auf die wir die Antwort gar nicht unbedingt wissen wollen: Was denken unsere Freunde tatsächlich von uns?
… fürs Herz: der Gedanke, wie es hätte sein können, hätten die Freunde sich einander geöffnet, hätten sie wirklich hingeschaut.
… fürs Gedächtnis: die schockierenden Gewaltausbrüche zwischen Jakob und Manja.
In Spuren ist erschienen im mairisch Verlag (ISBN 978-3-938539-18-7, 17,90 Euro).