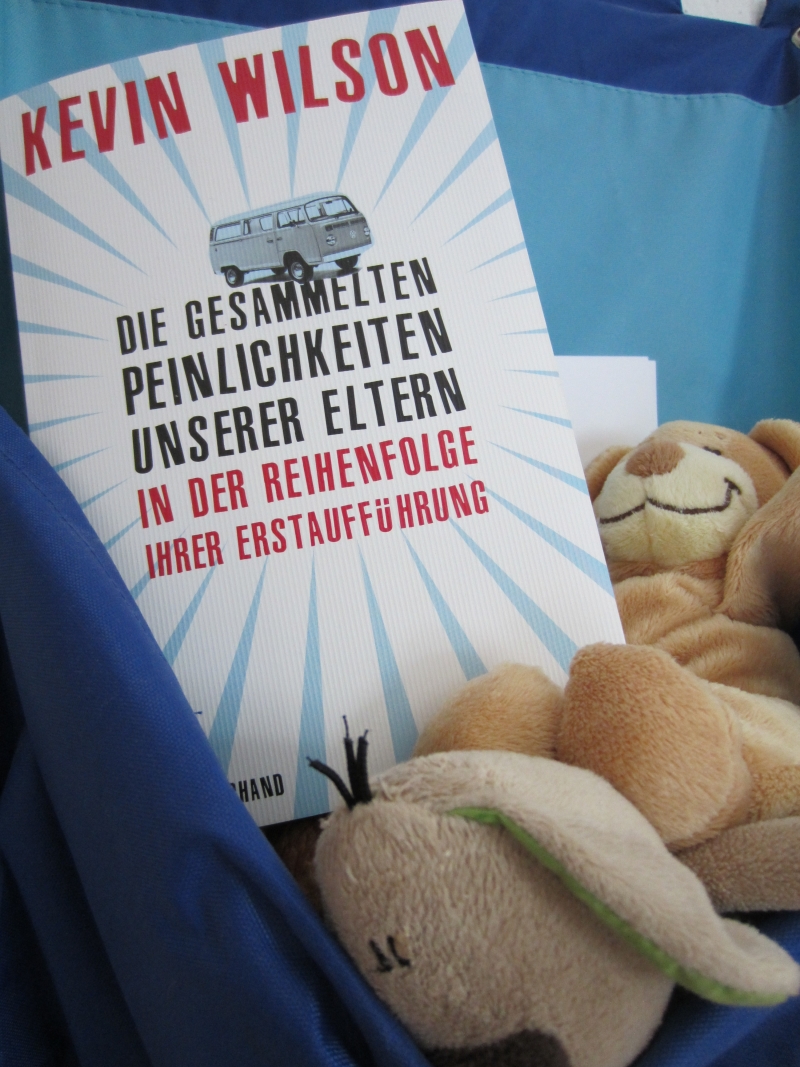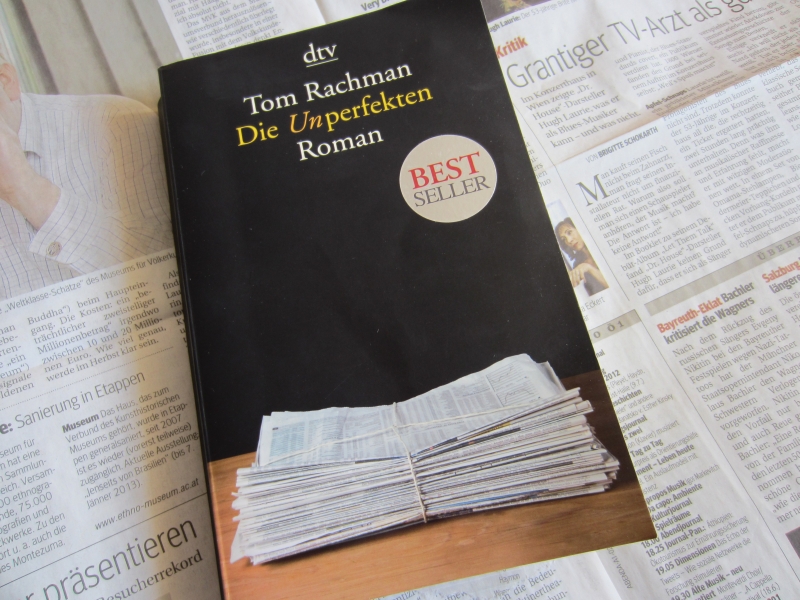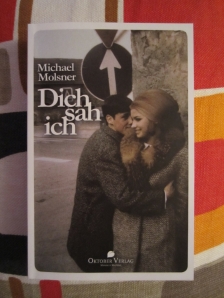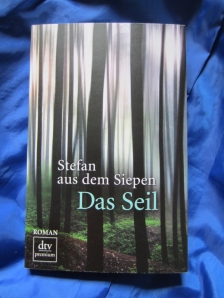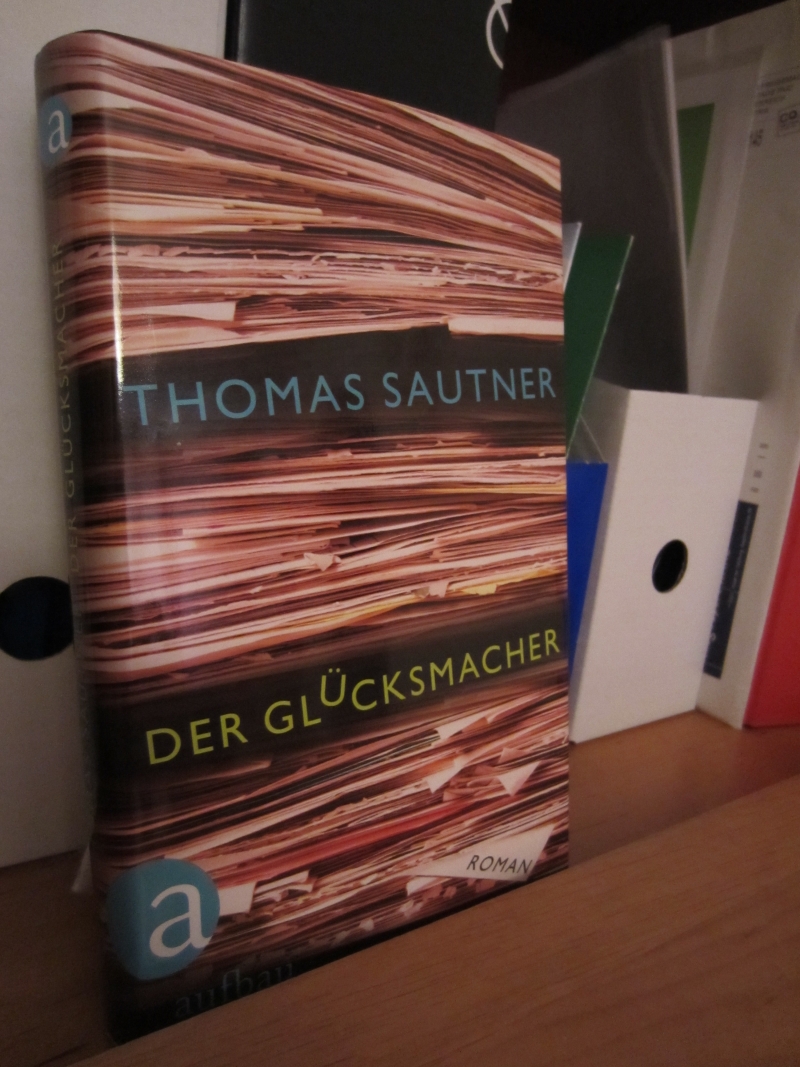 „So herzstechend schön ist das Glück erst, wenn man sich dessen Abwesenheit vorstellt“
„So herzstechend schön ist das Glück erst, wenn man sich dessen Abwesenheit vorstellt“
„Wenn das Glück keine Ruhe gab, dachte Dimsch in diesem Augenblick, wenn es ihm auf der Nase herumtanzte und sich ihm aufdrängte, listig meist als Wunsch getarnt, wenn die Sehnsucht nach Glück also unvermeidbar schien, es selbst aber launenhaft und flüchtig, so würde er sich nicht länger narren lassen. Fortan würde er verhindern, dass sich das Glück entzog, kaum in Besitz geglaubt. Fortan, Dimsch beschloss es eisern, würde er das Glück in die Enge treiben, es sich zu eigen machen, bändigen gnadenlos.“ So beginnt Sebastian Dimschs Suche nach dem Glück, bei dem er – seinem Charakter als ordentlicher Versicherungsbüromann – sehr systematisch vorgeht. Dimsch will endlich wissen, was es ist, das Glück, und deckt sich mit Literatur zum Thema ein. Einen Haufen Bücher von Philosophen, Psychologen und unbekannten Weltverbesserern nimmt er mit in die Arbeit, wo er genug Zeit hat, sie in aller Ruhe zu studieren, denn Dimsch – offiziell Abteilungsleiter Marketing und Statistik einer großen Versicherung – wurde wie seine zwei Mitarbeiter in ein abgelegenes Kammerl versetzt, wo nie jemand nach ihm sucht. Was ihn anfangs ärgerte, kommt ihm jetzt ganz gelegen: Er beschäftigt sich mit Platon und Sokrates, Konfuzius und Kant, ohne dass ihn jemand stört. Statt Anzug trägt er nun Jeans und alte Pullis, und während Chefin Irene und Marketingleiter Rainer ihn als lahmarschig und entbehrlich abstempeln, finden Dimschs Kollegen zunehmend Gefallen an seinen hilfreichen und aufmunternden E-Mails, in denen er seine neu entdeckten Erkenntnisse über das Glücklichsein mit ihnen teilt. Doch dann will auch die Firma was von Dimschs profitablen Wissen haben: Er soll eine Glücksversicherung entwerfen und den Kunden für teures Geld individuelles Glück verkaufen. Notgedrungen nimmt er die Herausforderung an – aber glücklich macht sie ihn nicht …
Der österreichische Schriftsteller Thomas Sautner hat mit seinem Protagonisten, dem Glücksmacher Sebastian Dimsch, eine alltagsheldentaugliche Figur geschaffen, die mir auf Anhieb sympathisch ist. Dimsch trinkt gern Bier, findet seine Kinder anstrengend, liegt auf der Schlagfertigkeitsskala im Minusbereich, verknallt sich auf den ersten Blick in die Büronachbarin – und wird in der Versicherung zum Handlanger degradiert, wogegen er sich wehrt, indem er einfach auf die Arbeit pfeift. Statt jeden Tag sinnlos die Zeit im Büro abzusitzen, verbringt er sie lieber mit der Suche nach dem Glück. Worin besteht es, warum ist es so unbeständig? Bei den Philosophen findet er Antworten, die ihn nachdenklich machen. Und ich werde bei der Lektüre dieses Buchs zu dem kleinen Mäuschen in seinem Büro, schaue ihm beim Lesen über die Schulter, flitze auf geheimen Wegen zur cholerischen Chefin und belausche sie beim Pläneschmieden, beobachte Eva und Rainer beim Knutschen und Dimschs Mitarbeiter bei ihrem äußerst schrägen Zeitvertreib. Quietschvergnügt und bestens unterhalten bin ich, eine sehr glückliche Maus, denn ich fühle mich in Thomas Sautners österreichisch-verquerem Stil heimisch, ich mag die feine Ironie und genieße die gewitzten Sätze ebenso wie die originellen Einfälle. Einen kleinen Dämpfer bekommt mein Mäuseglück gegen Ende des Romans, weil ich mir von der Glücksversicherung etwas mehr – wie im Klappentext angekündigt – Überraschung erwartet habe. Wer das aber nicht tut, wird sich mit dem Glücksmacher sicher rundum amüsieren – und dabei etwas lernen. Denn auf lockere, heitere Weise serviert Thomas Sautner deftige Kost: Jeder darf sich angeregt fühlen, über das eigene Leben, die noch offenen Wünsche und das persönliche Glück nachzudenken. Nehmen wir den Alltag zu ernst und die Arbeit zu wichtig? Können wir das, was wir haben, genug schätzen? Sebastian Dimsch gibt feixend den Rat: Mach’s wie die Maus – sei entspannt und genügsam, freu dich über die kleinen schöne Dinge im Leben, und wenn dir was nicht in den Kram passt, dann scheiß drauf.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: das Cover finde ich eher langweilig.
… fürs Hirn: bin ich glücklich? Wie kann ich es werden? Ein lesenswerter Roman, der ganz nebenbei dazu einlädt, das Leben umzukrempeln.
… fürs Herz:Protagonist Dimsch mit seiner tollpatschig-klamaukigen Art.
… fürs Gedächtnis: mein Lieblingszitat: „Unser Glück dauert immer nur einen Moment, sofort danach zerstören wir es mit unseren Gedanken. Genial wäre eine Moment-Schutzmaschine. Ja, sobald ein Moment des Glücks auftaucht, müsste man ihn beschützen vor unseren Gedanken.“
Der Glücksmacher von Thomas Sautner ist erschienen im Aufbau Verlag (ISBN 978-3-351-03510-5, 256 Seiten, 19,99 Euro).