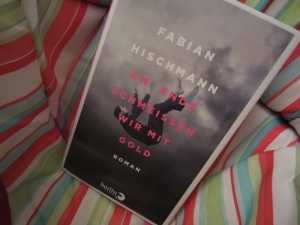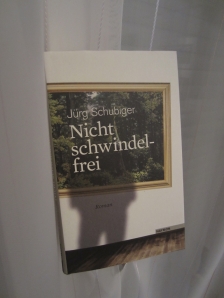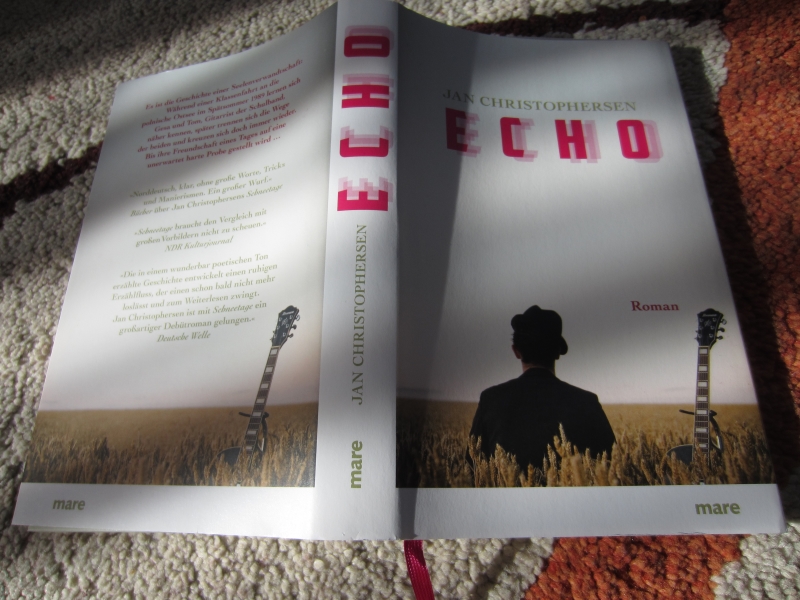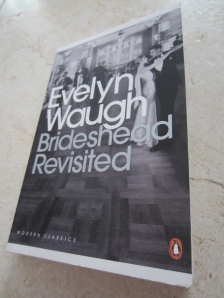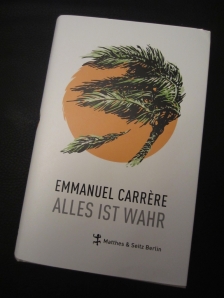 „Du als Schriftsteller, wirst du über all das schreiben?“
„Du als Schriftsteller, wirst du über all das schreiben?“
Dass ihr Hotel auf der „richtigen“ Seite des Strandes steht, rettet dem Schriftsteller Emmanuel Carrère und seiner Freundin Hélène sowie ihren jeweiligen Söhnen das Leben: Sie befinden sich 2004 während des Tsunamis auf Sri Lanka. In den Tagen, die auf die Riesenwelle folgen, erleben sie das Leid derer, die einen geliebten Menschen verloren und selbst überlebt haben, sie sehen Berge von Leichen, und sie, die sich gerade noch trennen wollten, sind derart erschüttert, dass ein ganz neuer Zusammenhalt zwischen ihnen entsteht: „Wir spürten, wie zerbrechlich unsere Körper waren. Ich sah den von Hélène an, so schön, so erschöpft von Müdigkeit und Schrecken. (…) Ich dachte: Sie könnte tot sein. Sie ist kostbar für mich. So kostbar. Ich möchte, dass sie eines Tages alt ist und ihre Haut müde und schlaff und dann möchte ich sie immer noch lieben.“ Wieder zuhause, wartet alsbald die nächste Tragödie: Hélènes Schwester Jeanette stirbt an Krebs. Ihre drei kleinen Töchter und ihr Mann Patrice bleiben allein zurück. Emmanuel erlebt das Geschehen unmittelbar, beobachtet es aber stets auch von außen: „Ich war und bin Drehbuchautor, mein Handwerk besteht unter anderem darin, dramatische Situationen zu konstruieren, und eine der Regeln dieses Berufs ist, keine Angst vor Übertreibung und Melodramatik zu haben. Und doch glaube ich, dass ich mir in einem fiktionalen Werk verboten hätte, etwas so unverschämt Tränenrühriges zu erfinden wie kleine Mädchen, die auf einem Schulfest tanzen und singen, während ihre Mutter gleichzeitig im Krankenhaus im Todeskampf liegt.“ Aber das Leben ist erbarmungslos, und Emmanuel hat sich selbst zum Berichterstatter gemacht – er gibt auch weiter, was ihm Jeanettes Arbeitskollege Étienne erzählt über seine Krebserkrankung, seine Amputation, seinen Beruf als Richter. Was uns all das sagt? Dass es jeden Tag ein Glück ist, wenn man noch mal davongekommen ist.
„Ich mag Auslassungen nur als Stilmittel, und auch nur, wenn ich sie richtig einordnen und genügend kontrollieren kann, sonst machen sie mir Angst. Vielleicht, weil es in meinem Leben einen Riss gibt. Und weil ich hoffe, ihn reparieren zu können, indem ich das Grundgerüst dieses Lebens so detailreich wie möglich beschreibe.“ Emmanuel Carrère, Tausendsassa in den Bereichen Regie, Drehbuch und Schriftstellerei, erzählt in Alles ist wahr genau das: alles, was passiert ist. Er tut dies mit chirurgischer Präzision und einer faszinierenden Mischung aus emotionaler Involviertheit und kritischen Distanz, die fast ein wenig makaber wirkt. Während der Lektüre fange ich an, nachzudenken, wie mein Leben klingen würde, fasste ich es auf so banale und zugleich lesenswerte Weise in Worte (wäre ich dazu fähig). Für mich ist alles, was Carrère schreibt, trotz des Wahrheitsgehalts Fiktion, weil ich keine der Figuren, deren Geschichten zwischen diese Buchdeckel gepresst sind, persönlich kenne, sie bleiben Romancharaktere für mich. Interessant finde ich Emmanuel Carrères Art, die Wahrheit zu sagen und die Lücken im Erlebten – die Gefühle und Eindrücke der anderen, die er nicht wissen kann – mit seiner Fantasie zu füllen, während er mich zugleich nie vergessen lässt, dass er eben genau das tut. Der Schreibprozess an sich ist stets Thema im Text. Das ist manchmal irritierend, manchmal auch schmerzhaft, weil es zeigt: Nichts ist erfunden, all diese Menschen sind wirklich gestorben. Dieses Buch ist ein kleines Stück Lebensgeschichte, ein Abbild, ein Ausschnitt von ein paar wenigen Schicksalen auf diesem Planeten, aufgezeichnet und festgehalten, um sie erinnerbar zu machen, greifbar, wenn auch nur auf dem Papier. Alles ist traurig, alles ist schön, alles ist wahr.
Alles ist wahr von Emmanuel Carrère ist erschienen im Matthes & Seitz Verlag (ISBN 9783882219517, 247 Seiten, 19,90 Euro).
Was andere über dieses Buch sagen:
„Alles ist wahr passt in unsere krisenhafte Zeit. Nicht nur, weil Carrère von existentiellen Verunsicherungen erzählt, sondern auch, weil er das mit dem Anspruch unironischer Aufrichtigkeit tut“, heißt es auf spiegel.de.
„Alles, was wir erleben, alles Leid und jede Geschichte, ist in ihren Facetten wahr, so, wie wir sie erleben. Und sie ist es wert, erzählt zu werden. Kaum jemand kann das heutzutage besser als Emmanuel Carrère“, schreibt Sophie von literaturen.
Und bei ocelot.de könnt ihr den Roman bestellen.