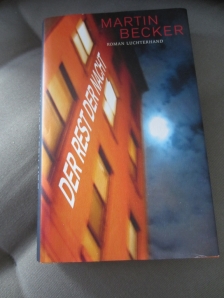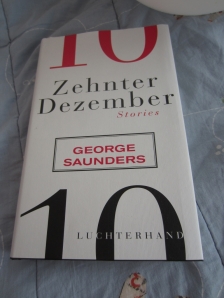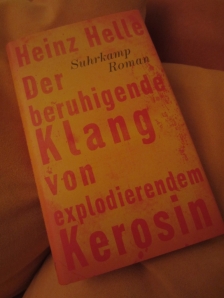„Ich bin immer neugierig, neugierig auf Menschen, die nicht aus dem Takt kommen, wie machen die das?“
„Ich bin immer neugierig, neugierig auf Menschen, die nicht aus dem Takt kommen, wie machen die das?“
Das lief nicht wie geplant. Denn eigentlich wollte Saskia in Brasilien nur eine geile Zeit haben. Vor allem mit dem schönen Raffael, in den sie sich verliebt hat. Doch der war nur auf ihr Geld aus, um Drogen zu kaufen, und mit dem Kind, das Raffael ihr gemacht hat, hockt Saskia jetzt im trüben Deutschland. Und sie hasst es. Mia ist zwei Jahre alt, und Saskia müht sich ab, kellnert, füttert, wickelt, versucht, sich um das kleine Wesen zu kümmern, und scheitert immer wieder daran. Sie hat keinen Kitaplatz und niemanden, der ihr hilft, die Mutter ist tot, der Vater Alkoholiker. Sie will kein Kind, sie will jung sein, reisen, weg aus Deutschland, trinken, kiffen: „Sie zerrt an meinem Arm, Mama, sagt sie, was für ein Wort, schwer von Verantwortung, schwer von Plackerei, Mama, die für alles Zuständige, Mama gleich Pflicht. (…) Mama?, eine verstörte Frage diesmal, ach, Kind, ich kann es einfach nicht, Mama sein.“ Deshalb haut Saskia erst einmal ab, lässt Mia zurück in der WG voller Medizinstudenten, die sie kaum kennt und von denen sie nicht weiß, ob sie sich um das Kleinkind kümmern. Sie fährt nach Norden, zum Meer, auf eine Insel, sie probt das Alleinsein, das Verlassen. Sie hat keine Ahnung, was sie tun soll. Und sie muss sich der Frage stellen, was wohl für Mia am besten ist: eine Mutter zu haben, die fast am Muttersein erstickt? Oder zurückgelassen zu werden?
Kathrin Gross-Striffler ist eine preisgekrönte deutsche Schriftstellerin, die sich in ihrem jüngsten Roman einer Mutter widmet, die alles, alles will – außer Mutter zu sein. Das ist freilich eine Pattsituation, der die junge, wütende, ungeduldige Protagonistin nicht entkommen kann. Sie hungert nach dem Leben, das für sie überall stattfindet, nur nicht in dem Zimmer mit dem quengelnden Kleinkind, sie will Sonne, Spaß, Alkohol, Freiheit. Stattdessen gibt es Geldknappheit, Einsamkeit, stinkende Windeln, knurrende Mägen und verständnislose Freundinnen. Saskia hasst alles und jeden, sprudelt über vor Zorn, hat keinen Plan und keine Geduld. Man mag es ihr nicht verdenken, sie ist tatsächlich angeschmiert so als alleinerziehende Jungmama ohne Hilfe. Ich kann ihre Gefühlserschütterungen gut nachempfinden. Ich weiß, wie anstrengend kleine Kinder sind, ich habe zwei, wie sie an den Nerven zerren, fordern, brauchen, Verantwortung auferlegen. „Es ist immer die Mutter, die beim Kind bleibt, die das Feuer hütet, nicht wahr.“ Ja. Außer die Mutter geht. Und das ist natürlich das große Tabu – das dieser Roman thematisiert und bricht.
Zum Meer ist wie ein einziger, atemloser Monolog mit langen Sätzen und einem rasanten Erzähltempo. Ich bin direkt drin in Saskias Kopf, und sie schlägt mir ihre Gedanken um die Ohren, ihre Zweifel, ihre Sehnsüchte. In einem langen, stellenweise doch recht anstrengenden Strom an Worten kotzt diese junge Mutter alles aus sich raus: die Angst, die Verzweiflung, aber auch die Liebe. Ich bin interessiert und abgestoßen zugleich, voller Verständnis und voller Abneigung. Mehr als einmal will ich diesem egozentrischen, eingebildeten, unwissenden und weinerlichen Gör einfach nur ins Gesicht schlagen. Kathrin Gross-Striffler hat den Zwiespalt, in dem ihre Figur steckt, sehr detailliert und gut dargestellt. Freilich kommt das nicht ohne Klischees aus, ist doch das Thema selbst schon ein Klischee: dass es einfach scheiße ist als alleinerziehende Mutter. Dieses Buch gibt aber einen lesenswerten Einblick in ein solches beispielhaftes Leben – und eine mögliche Antwort auf die eingangs gestellte Frage.
 Zum Meer von Kathrin Gross-Striffler ist erschienen im Aufbau Verlag (ISBN 978-3-351-03291-3, 252 Seiten, 19,95 Euro).
Zum Meer von Kathrin Gross-Striffler ist erschienen im Aufbau Verlag (ISBN 978-3-351-03291-3, 252 Seiten, 19,95 Euro).
Noch mehr Futter:
– „Eine Happyend-Autorin ist Kathrin Groß-Striffler gewiss nicht“ , heißt es im Buchtipp auf br.de.
– Hier könnt ihr euch den Film dazu anschauen, in dem sich auch die Autorin äußert.
– „Mit einem berauschendem Tempo steigt man ein in eine Geschichte von Überforderung, Weltwut – oder konkreter: Deutschland-Wut – von der Angst davor Mutter zu sein in einer Zeit, in der man selbst noch eine braucht“, schreibt Eileen Eichstädter auf literaturkritik.de.
– Hier könnt ihr das Buch bei ocelot.de bestellen.