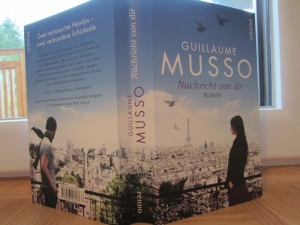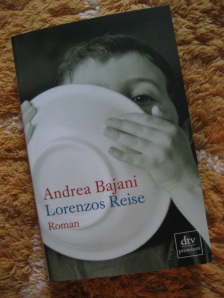“Und alles, was lebt, hat eine Aufgabe, an der es sich zerreibt”
“Und alles, was lebt, hat eine Aufgabe, an der es sich zerreibt”
Schramm unterrichtet nicht mehr. Nach dem, was vorgefallen ist zwischen ihm und dem Schüler Waidschmidt, kehrt er nicht an die Schule zurück. Dabei hat er das Unterrichten gemocht, er war ein guter Lehrer, wenn auch nicht unbedingt beliebt, die Struktur des Alltags gefiel ihm – obwohl er gar nicht Lehrer hatte werden wollen. Sein Leben lang wohnte Schramm im Mutterhaus, eine Frau ist nicht bei ihm geblieben. Die Mutter ist mittlerweile verstorben, nur Schramm und das leere Haus sind noch da. „Und es war nicht so, dass es immer ein Ereignis geben musste, einen Grund, weshalb die Dinge waren, wie sie waren. Stattdessen dieses Hinüberschleichen, von einem Zustand in einen anderen, so langsam, dass einer es erst wahrnimmt, wenn der kritische Punkt längst erreicht ist.“ An diesem kritischen Punkt beginnen die längsten großen Ferien für Schramm: jene, die gar nicht mehr enden werden. Auf dem Boden seiner Einfahrt kniet Schramm, kämpft geduldig gegen die Kriechgewächse und denkt nach, über den Bruder, über dessen schlechtes Verhältnis zum Vater, über die Eltern, die Schule, Waidschmidt. Der Bruder hat sich zum Besuch angekündigt und Schramm könnte vielleicht Zuflucht suchen in einem Gespräch mit ihm, aber: „Es ließ sich nicht miteinander reden.“ Verbittert ist Schramm, aber viel zu verbissen, um es sich einzugestehen, und zutiefst einsam.
Große Ferien von Nina Bußmann ist deutsche Literatur in reinster Form. Tiefdeutsch ist jeder Satz, bleischwer und tönern und aussagekräftig. Nina Bußmann schreibt mit tragender Stimme und mit Gewicht; Heiterkeit und Leichtfüßigkeit sucht man in diesem Roman vergebens. Sie würden auch nicht zum Inhalt passen, zum inneren Monolog eines Mannes, der kaum Fehler gemacht hat und sich wundert, wie er dennoch scheitern konnte. Mit ihrem eleganten, verschrobenen, bedeutungsschwangeren Stil reiht die junge Nina Bußmann sich ein in die Parade großer deutscher Autoren und wird von der Kritik gefeiert. Dies ist für mich ein Roman, der ausschließlich über die Sprache funktioniert, ein Stilroman, in dem die eigentliche Geschichte hinter dem präzisen, überlauten Erzählton fast verschwindet. Nina Bußmann zerlegt ihren Schramm in seine Einzelteile, sie ätzt alles weg, was ihn ausmacht, bis nur sein Kern bleibt, und trotzdem gelingt es Schramm, allerhand vor mir zu verbergen. Ich lese, was er denkt, und woran er nicht denken mag, das erfahre ich nicht. Er ist pedantisch, er sticht auf das Unkraut ein und will Ordnung erzwingen.
Stets warte ich auf Interaktion mit einem anderen Menschen, auf das Auftauchen des Bruders, an den Schramm sich laut Klappentext wendet, doch ich warte vergebens, das Buch bleibt in Schramms Gedanken- und Erinnerungswelt gefangen. Er springt hin und her zwischen dem Erleben, dem Säubern der Bodenplatten, und dem Erinnern an die Begebenheiten der Vergangenheit. Das ist etwas, das mir viel Aufmerksamkeit abverlangt und das ich dennoch sehr mag, denn ich will beim Lesen durchaus gefordert werden. Und neugierig bin ich natürlich auf die Sache mit Waidschmidt, einem undurchsichtigen, vielleicht sehr klugen, in jedem Fall besonderen Typen: „Aber bei einem wie Waidschmidt wusste man nie, ob er, was er sagte, ganz meinte, ob er es nur sagte, um sich etwas einzigartiger zu machen, wie er es mit seinen gebügelten Hemden, seiner Ledermappe tat“, sagt Schramm über den Schüler, der ihn bedrängt, fasziniert und zu Fall gebracht hat. Wobei das Schramm gar nicht so sehr zu stören scheint, so resigniert und abgeklärt klingt er. Persönlich hätte ich mir letztlich doch ein wenig mehr Klarheit und Aufklärung gewünscht, aber beeindruckt hat mich Nina Bußmann mit ihrem lesenswerten Werk über Schuld und Scheitern, Bedeutungslosigkeit und Einsamkeit allemal. Es hat sich angefühlt wie ein Spaziergang über einen alten, längst aufgegebenen Friedhof, an dem sogar die Erinnerung langsam in einem Grab verschwindet – nicht gruselig, nur hoffnungslos.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: was das Wurzelwerk und der Baum mit dem Buch zu tun haben, ist mir schleierhaft – vielleicht eine Andeutung auf das Unkraut, das Schramm entfernt?
… fürs Hirn: alle Achtung, großartiger Stil!
… fürs Herz: nichts, denn Schramms Herz ist wie eine vertrocknete Schrumpelfrucht.
… fürs Gedächtnis: nichts vom Inhalt, aber einiges von der gewichtigen Sprache.