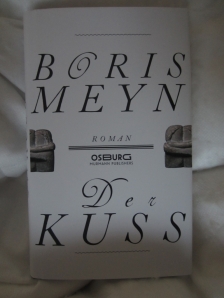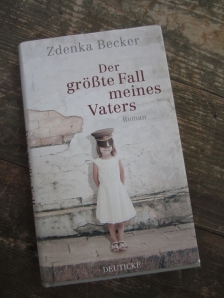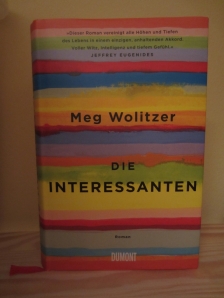Im Wald, im Wald ist’s dunkel und kalt
Im Wald, im Wald ist’s dunkel und kalt
Da ist ein Wald. Neben dem Wald ist ein Haus. Und in dem Haus ist etwas passiert. In dem Haus war Blut, und in der Garage hat das Fahrrad gefehlt, und dann gab es Geschrei und Schuldzuweisungen. Deshalb wohnt die Pflegetochter Lisa jetzt im Heim. Sie ist möglicherweise verrückt, irgendwie anders, keiner will etwas zu tun haben mit ihr. Den Wald, den gibt es noch. Das Haus, das steht noch daneben. In dem Haus wohnen jetzt Karin und ihr Freund Alexander. Und dann holt Karin ihre Schwester Lisa in das Haus zurück.
Das Debüt Wie im Wald der österreichischen Autorin Elisabeth Klar ist ein verstörendes, unheimliches, mörderisch anstrengendes Buch. Die Schriftstellerin leitet die Literaturwerkstatt Wien und wurde für ihre Erzählungen mit zahlreichen Preisen bedacht. Ihr Stil ist sehr eigen, sie schreibt Sätze wie Fesseln, lange Stricke, die mich an den Wald binden und an das Haus, die mich gefangen nehmen und einsperren in all die angeknacksten Psychen. Niemandem in diesem Roman geht es gut, alle tragen ihr Päckchen, alle misstrauen einander, alle schweigen. Was passiert ist, nun, das ist keine Überraschung, weil was kann schon passieren zwischen Pflegevater und halbwüchsiger Tochter, ja eben, genau. Und das ganze Buch dreht sich um das Nicht-Sprechen darüber, um das Nicht-Erinnern, um die Konkurrenz, die es gab zwischen Karin und ihrem Vater wegen Lisa. Dies ist ein Roman voller Worte, die das Schweigen verdecken sollen, sehr viele Worte sind es, aber das Schweigen hört man trotzdem. Es ist schwierig, ihn zu beschreiben, über ihn zu reden, weil er so vertrackt ist und ihr ihn selber spüren müsst – deshalb soll er selbst ein bisschen zu euch sprechen:
„Vielleicht ist es ja ein Schmetterling gewesen, denke ich, als ich Lisa und Alexander beim Spielen zusehe. Vielleicht sind sie beide Schmetterlinge gewesen, August und Lisa, und waren im Einklang dieser selben schmetterhaften Existenz. Vielleicht gingen ihre Gespräche um nichts und um alles und drehten und flatterten und waren doch nicht richtig möglich. Vielleicht haben sie nur so getan, als würden sie sprechen, haben nur die Lippen geöffnet und geschlossen und waren nicht lauter dabei als ihr eigener Flügelschlag.“
„Wir beide sind von einer Seele, Lisa, das weiß ich ganz genau. Du siehst sie, genau wie ich sie sehe. Dabei haben sie mich nie geschlagen. Aber das Gefühl hab ich gehabt, als ob sie mich ständig erschlagen könnten. Das Gefühl hab ich gehabt, als hätten sie ständig ihre Hand erhoben gehabt zum Schlag. Verbrennen hätte ich können unter ihren Blicken.“
„Wie sich deine Finger in meinen Rücken krallen, nimmt es mir fast die Luft weg. Gleichzeitig ist es notwendig. Verlieren wir uns in diesem Moment, verlieren wir alles, und alles kippt. Und doch. Noch während du meinen Körper so an dich drückst, als wären wir miteinander verwachsen, spüre ich, wie du dich anspannst, dich schon vorbereitest, dich von mir wegzustoßen. Ich spüre alles in dieser Umarmung, denn alles ist in dieser Umarmung enthalten, auch das, wovon wir noch nichts wissen.“
„Und was. Was, wenn wir im Wald spazierengehen. Was, wenn wir aufbrechen, durch den Waldrand brechen wie durch die Wasseroberfläche, das Wasser schlägt über uns zusammen und legt sich in unsere Ohren und auf unseren Mund und auf unsere Haut, kriecht in jede Höhle und dämpft, wie Wasser alles dämpft, kaum hat man ihn betreten, und schließt sich hinter uns.“
„Meine Worte legen sich auf meinen Hals und drücken. Ich halte dich in Händen. Überall sind sie wie Zungen, und er hält mich, und überall um seine Hände herum wuchere ich, und höre nirgendwo auf, in alle Richtungen höre ich nicht auf.“
„Sie kommt zu mir, unter die Decke. Ihre Haut legt sich an meine Haut. Meine Haut hört an ihrer Haut auf. Weil ihre Haut an meiner liegt, muss ich für einen Moment nicht weiter wachsen.“
Elisabeth Klar: Wie im Wald. Residenz Verlag 2014, 272 Seiten, 22,90 Euro. Und hier könnt ihr das Buch bei ocelot.de bestellen.