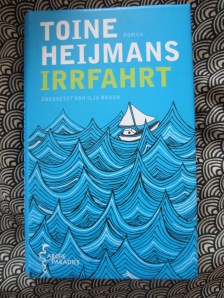Von der Frage nach der Schuld und der Unmöglichkeit, sie zu beantworten
Von der Frage nach der Schuld und der Unmöglichkeit, sie zu beantworten
„Ich sitze hier, damit niemand vergessen kann. Solange es Menschen gibt, die erzählen, bleibt die Erinnerung wach und die Hoffnung, dass die Schuldigen bestraft werden.“ Das sagt einer der Zeugen im Prozess gegen Zlatko Šimič vor dem Kriegsgericht in Den Haag, wo er angeklagt ist, weil er im jugoslawischen Krieg 42 Menschen in ein Haus gelockt haben soll, das auf sein Geheiß hin angezündet wurde. Nur ein Mädchen hat überlebt – und erzählt seine Geschichte. Unter den Zuhörern befindet sich der junge Robert, der extra aus Deutschland angereist ist. Robert liebt Ana, und Ana ist Zlatkos Tochter. Bevor er Ana kennenlernte, interessierte Robert sich nicht für seine kroatische Abstammung, jetzt tut es ihm leid, dass er Anas Sprache nicht beherrscht. Vielleicht hätte sie dann einen Weg gefunden, mit ihm zu sprechen, das Geheimnis rund um ihren Vater, das sie so sehr belastet, mit ihm zu teilen. Das ist nicht geschehen, und so sucht Robert in Den Haag eine Antwort auf die Frage, ob Anas Vater ein Verbrecher ist und wie er die Beziehung zu Ana retten kann.
„Ich weiß nicht, warum, aber es ist offenbar immer der Vater, an dem man sich ein Leben lang reibt, dessen Stimme bis ins Alter nachklingt.“ Dies ist sozusagen das Motto für Nicol Ljubić‘ Roman Meeresstille, in dem eine Vater-Tochter-Beziehung im Mittelpunkt steht, die unter einer großen Schuld zerbrochen ist. Zum Ich-Erzähler macht der kroatische Autor, der in Berlin lebt, aber weder Vater Zlatko noch Tochter Ana, sondern deren Freund Robert, einen Außenstehenden, der durch seine Gefühle für Ana dennoch involviert ist. Er ist verwirrt und verletzt, er hat keinen Bezug zum Krieg in seiner Heimat, und er hadert damit, dass ihm ein Hindernis den Weg zu Ana versperrt, das er nicht aus dem Weg räumen kann: die Gräueltaten eines Fremden. Gemeinsam mit Robert sitze ich im Gerichtssaal und lausche den Schilderungen von den Grausamkeiten, die Zlatko begangen haben soll, höre die Schreie der Eingeschlossenen und das Knistern des Feuers. Wir sind entsetzt, Robert und ich, befremdet und abgestoßen, wir suchen nach der Wahrheit in den Aussagen der Zeugen und den Augen des vermeintlichen Verbrechers. Aber wir finden nur unsere eigenen Zweifel.
In Meeresstille fragt Nicol Ljubić nach der Unfehlbarkeit von Schuldzuweisungen und Urteilen. Sein Blick ist dabei hart und gnadenlos, und er fängt all das Schreckliche ein, das dieses Kriegsverbrechen ausgelöst hat: den Tod vieler unschuldiger Menschen, das Zerbrechen einer Familie, das Scheitern einer Beziehung in der nächsten Generation. Der Krieg, der vorbei ist, gärt noch in den Menschen, die getroffen wurden, er zeigt sich als Virus, das sich weiter überträgt und nicht bekämpft werden kann. Dieser Roman macht keine Späße, er meint es mit jedem Satz ernst. Er hat keine Zeit für Schnörkeleien und nette Wortspiele, und er hat keine Geduld für Poesie. Er will erzählen, damit nicht vergessen wird, er will berichten und mit dem Finger auf jene zeigen, die getötet haben – auch wenn es sich nicht beweisen lässt. Ein sehr trauriges, anklagendes, wichtiges Buch.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: von der Farbgebung her gefällt mir das Cover, das Motiv selbst finde ich zu banal.
… fürs Hirn: die Probleme, die unser Rechtssytem aufwirft, die Frage nach der Möglichkeit, die Wahrheit aufzudecken, und das ewige Fortdauern von Schuld.
… fürs Herz: Roberts Liebe zu Ana.
… fürs Gedächtnis: der Schmerz aller Beteiligten.