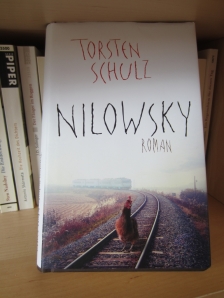„Die Liebe ist eine gute Institution. Sie wird nie aus der Mode kommen“
„Die Liebe ist eine gute Institution. Sie wird nie aus der Mode kommen“
Eigentlich hat er ja angefangen zu studieren. Aber dann hat er ein bisschen den Antrieb verloren, und jetzt liefert er einfach mal Gemüse aus. Der 30-jährige Ich-Erzähler findet es ganz angenehm, auf einsamen Wegen durch den Schwarzwald zu fahren. Dass es aber auch schön sein könnte, sein Leben mit jemandem zu teilen, merkt er, als er in der Kneipe die Künstlerin Theres kennenlernt: „Theres mit ihrem Lachen, das hüpft wie eine Bachstelze über Steine.“ Zuerst sieht es so aus, als würde er nicht an sie herankommen, doch dann entspinnt sich eine zarte Liebesgeschichte, die nicht den üblichen Regeln folgt. Denn Theres ist anders, sehr sprunghaft, unberechenbar und launisch. Alles, was den Ich-Erzähler anfangs fasziniert hat, wird zur Belastung für ihn, denn er kann keine Zukunft mit Theres planen, sie nimmt es mit der Treue nicht so genau, und ihre Stimmungsschwankungen untergraben das Fundament ihrer Beziehung. Lange versteht er nicht, was mit Theres los ist und dass ihre unkontrollierbaren Launen einer Krankheit entspringen.
Wir zwei allein von Matthias Nawrat ist eine ungewöhnliche Liebesgeschichte. Und ich mag ungewöhnliche Liebesgeschichten. Unperfekt müssen sie sein und ein bisschen schief, leicht angeschlagen und irgendwie schrullig. Natürlich ist das Normale viel zu normal, um einen Roman darüber zu schreiben, vor allem, wenn es um die Liebe geht. Also entwirft der in Polen geborene Autor zwei Figuren, die ein wenig angeknackst daherkommen: einen Mann, dessen erster Lebensentwurf gescheitert ist, und eine Frau, die gar keinen hat. Ein Gemüsefahrer und eine Künstlerin, zwei einsame Seelen, zwei Körper, die Wärme brauchen: „Hast du schon einmal versucht, Wolle zu essen, sagt sie, und das letzte Stück in der Hand zu behalten, so dass du nach dem Klo wie eine Perle aufgefädelt bist, bereit, jemandem um den Hals gehängt zu werden? Nein, sage ich. Ich auch nicht, sagt sie.“ Die Liebe der beiden ist wie ein scheuer Vogel, sie zeigt sich, hüpft und tiriliert, lässt sich aber nicht greifen. Und da dem Ich-Erzähler das eigentliche Problem so lange nicht klar ist, tappe auch ich im Dunkeln und werde immer verwirrter. Zwar folge ich dieser komplizierten Liebelei durchaus gern, aber die gewünschte Sogwirkung übt der Roman nicht auf mich aus. Ich verirre mich zwischen all den Fäden, in die die zwei Protagonisten sich verwickeln, und von beiden kann ich verschiedene Handlungsweisen weder nachvollziehen noch verstehen. Was aber auch nicht weiter schlimm ist – schließlich wollte ich es ja so mit dem Ungewöhnlichen. Trotzdem bleibt bei mir das Gefühl, dass die Geschichte nicht gehalten hat, was sie mir am Anfang versprochen hat: viel Tiefgang und ein bisschen Leuchten. Doch letztlich breitet sich in dieser Liebesgeschichte wie in jeder anderen auch großes Schweigen aus.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: die Karotte ist unbezahlbar genial.
… fürs Hirn: dass alles, was einen anfangs fasziniert, irgendwann nervt.
… fürs Herz: nun ja, es ist eine Lovestory.
… fürs Gedächtnis: ein Lieblingszitat: „Sonntage sind in Wahrheit Gemälde aus der Romantik. Weil die Menschen nicht arbeiten, gibt es nur das Wetter, sonst passiert nichts.“