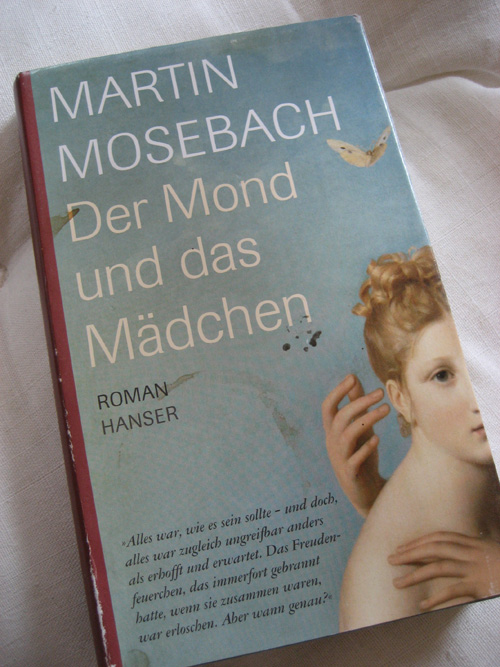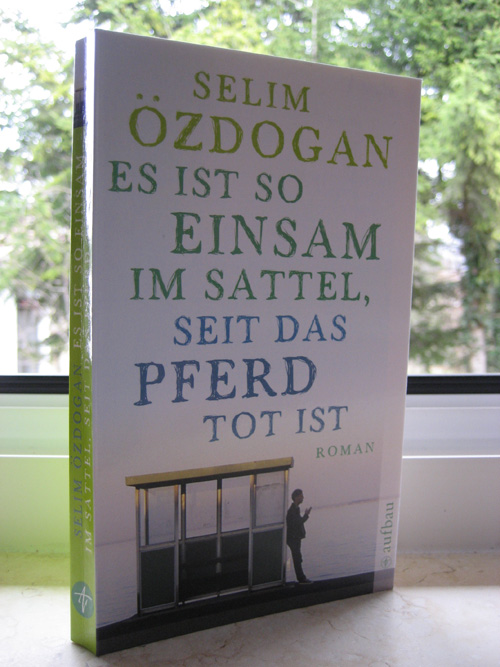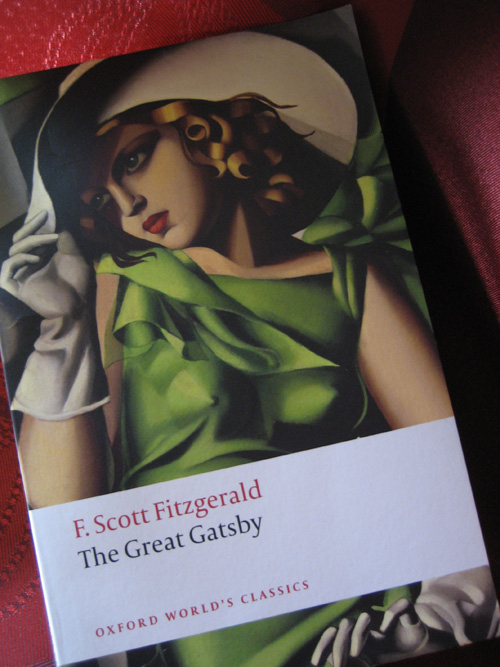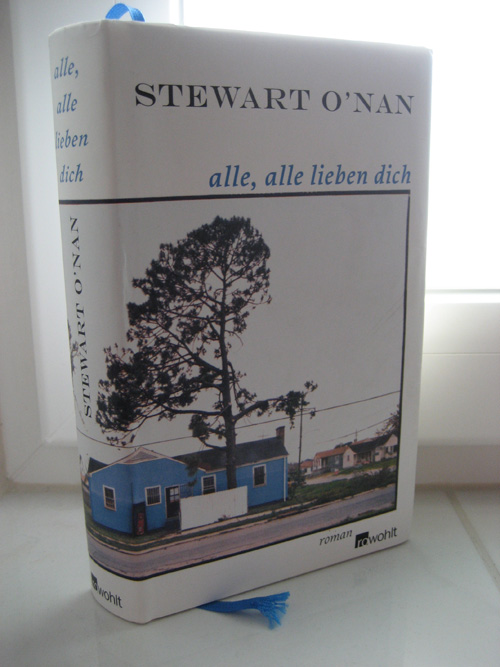Die Geschichte einer Frau, die nichts verpasst hat
Die Geschichte einer Frau, die nichts verpasst hat
Mit The Private Lives of Pippa Lee ist Rebecca Miller in den USA ein Bestseller gelungen, der 2009 verfilmt wurde und heuer in unsere Kinos kommt. In diesem Roman erzählt sie von Pippa, einer Frau, die mit dem 30 Jahre älteren Schriftsteller Herb verheiratet ist und ein beschauliches, kultiviertes Leben führt. Die beiden sind gerade in eine Wohnanlage für Senioren gezogen, Pippa bekocht gern Gäste, ihre Kinder, die Zwillinge Grace und Ben, sind längst erwachsen. So beginnt das Buch – und dann wechselt die Perspektive: Als Ich-Erzählerin berichtet Pippa von ihrer Kindheit und Jugend, von allem, was passiert ist, ehe sie Herb traf. Pippas Mutter kämpfte mit depressiven Stimmungen und Tabletten, ihre Beziehung zu Pippa war sehr eng, aber instabil. Und so wurde aus Pippa eine wilde Jugendliche, die sich schon mit 16 allein durch New York schlug. Sex, Drogen, wilde Partys und Alkohol bestimmten ihren Alltag. Erst als sie Herb begegnete, kehrte Ruhe in ihrem Leben ein. Zwar war Herb zu Beginn noch verheiratet, aber – nun ja – nicht mehr lange …
Spannung bekommt dieser Roman durch den starken Kontrast zwischen Pippas Jugend und ihrem späteren Leben, der durch den Wechsel der Erzählperspektive noch verstärkt wird. Am Ende stellt sich jedoch heraus, dass Pippas Leben bei Weitem nicht so ruhig ist wie gedacht – auf sie und den Leser wartet noch eine deftige Überraschung. Die unerwarteten Wendungen sind es auch, die dem Buch Aufwind geben – denn ansonsten ist die Geschichte eher unspektakulär. Zwar ist Pippas Geschichte alles andere als langweilig – dafür sorgen lesbischer Sex, Selbstmord und Kindererziehung. Aber weder der Stil noch die Handlung an sich sind ungewöhnlich genug, um den Roman zum eye-catcher in der Flut der täglich erscheinenden Bücher zu machen. Pippa erlebt alles sehr bewusst, die Erzählung bleibt nah an ihren Gefühlen und Eindrücken. Sie ist eine manipulative Frau mit vielen Gesichtern, eine schillernde Figur. The Private Lives of Pippa Lee ist angenehm und flüssig zu lesen, es ist ein gutes Buch – aber kein herausragendes.