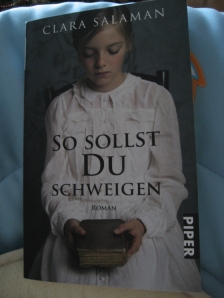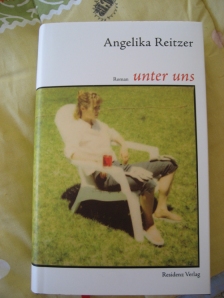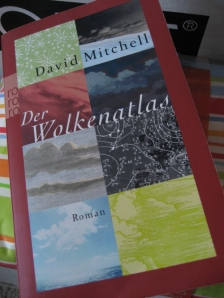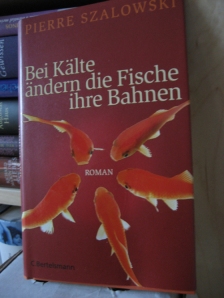“Elf Jahre alt zu sein macht uns unsichtbar”
“Elf Jahre alt zu sein macht uns unsichtbar”
“Wir haben 1978, und die Realität ist schon erschöpft”: Die Roten Brigaden stürzen sich voller Wut auf Italiens Ordnung, im ganzen Land ist das Bild des toten Aldo Moro im Kofferraum präsent. Infiziert vom Fieber, etwas zu ändern, zu bewegen, schuldig zu sein, sind drei elfjährige Buben in Palermo. Sie geben sich die Kampfnamen Nimbus, Strahl und Flug und beginnen im Sommer 1978 mit einem ganz besonderen, unheilvollen Training: Sie stählen ihre Körper und ihren Geist, erfinden einen eigenen Kommunikationscode und bereiten sich auf Kampfaktionen vor. Gegen wen sie kämpfen sollen, das fragt sich auch Ich-Erzähler Nimbus: “Ich weiß nicht, wovon er redet. Wir sind immer im Kampf, sagt er. Aber ich verstehe nicht, gegen wen. Und wer kämpft gegen uns? Ebenso wie Flug verspüre ich das Bedürfnis, verfolgt zu werden, und ich wünsche mir einen beharrlichen und liebevollen – ja, liebevollen – Feind, der mich achtet, indem er mich verfolgt. Nur dass es diesen Feind nicht gibt.” Das jedoch hindert die drei nicht daran, ihre theoretischen Gedanken zu Revolution und Terror in die Tat umzusetzen: Sie werden gewalttätig, schuldig, zerstören fremdes Eigentum und schrecken nicht vor Grausamkeit gegen Menschen zurück. Während die Eltern und der kleine Bruder von Nimbus – er nennt sie Schnur, Stein und Lappen – keine Ahnung von seiner Brutalität haben und sich ihm somit nicht in den Weg stellen können, scheint es eine einzige Person zu geben, für die Nimbus etwas empfindet: das kreolische Mädchen. “Denn jedes Mal, wenn ich sie ansehe, wird mir ganz feierlich zumute, und ich verspüre das Bedürfnis nach Zärtlichkeit – genau jenes Bedürfnis, das der Kampf tagtäglich ausschließt.” Doch wer liebt, ist verwundbar, und für einen Kämpfer bedeutet das große Gefahr …
Mit Die Glasfresser hat der italienische Autor Giorgio Vasta, der selbst aus Palermo stammt, einen schockierenden Roman über Fanatismus, Gewalt und Gefühllosigkeit geschrieben. Die Sprache benutzt er dabei wie ein ungemein scharfes Schwert, seine Worte sind Rasierklingen – mit diesem Buch bekommt Sprachgewalt eine ganz neue, viel direktere Bedeutung. Der Grundgedanke der Brutalität ist in vielen Formulierungen versteckt, zeigt sich in der Wortwahl, schimmert immer wieder durch: “Während wir uns unter die Leute mischen, sehen wir nur vom Dialekt zerfleischte Gesichter – der Dialekt explodiert in den Mündern und zerfetzt die Gesichtszüge, er wird erzeugt im Dunkel der familiären Bindungen, im täglichen Zusammenstoß, eine Stirn gegen einen Jochbogen, der Mund gegen eine Schläfe.” Sehr körperlich ist diese Sprache, aber auch sehr intellektuell, punktiert mit Fremdwörtern, die nicht im täglichen Sprachgebrauch vorkommen: rachitisch zum Beispiel, Defätismus, effeminiert. Die Sätze sind ausufernd, sie klirren und schmerzen, sie schneiden den Leser mitten in die Brust – denn ihr Inhalt ist Hass.
Es ist heiß und trostlos in Palermo im Sommer 1978, als der Wahnsinn und die Gier, bedeutsam zu sein, drei Buben zum Äußersten treiben. Ich-Erzähler Nimbus wirkt hochintelligent, die Welt langweilt ihn: “Ich bin ein Gottloser und weiß alles, ich habe die Herrschaft: Das Leben ist die Frucht, und ich bin ihr Kern.” Wie seine Freunde Scarmiglia und Bocca, die Genossen Flug und Strahl, ist er abgeschnitten von Menschlichkeit und Mitgefühl, besessen von den grausamen Aktionen der Brigadisten, hungrig nach einem Kampf: “Elfjährige Zeitungsleser, Fernsehnachrichtenschauer. Beobachter des politischen Geschehens. Konzentriert und schonungslos. Kritisch, finster. Präadoleszente Außenseiter.” Diese drei, die eigentlich noch Kinder sind, wenden sich gegen Schwächere – nur weil sie es können. Nimbus’ liebstes Spielzeug ist ein Stück Stacheldraht, mit dem er Tiere quält. Wahnsinnig sind Giorgio Vastas Protagonisten, fanatisch und diszipliniert – und erst elf Jahre alt. Ich war mit elf nicht unbedingt stumpfsinnig, aber davon, eine solche Weltanschauung zu ersinnen und so zu reden, wie Die Glasfresser es tun, war ich kilometerweit entfernt. Dass Nimbus, Strahl und Flug so extrem jung sind, hebt die krasse Sinnlosigkeit ihrer Taten hervor – wirkt aber auf mich auch unglaubwürdig. Dreizehn vielleicht, vierzehn, aber elf? Zudem hatte ich mir erwartet, die Miniterroristen würden nachplappern und nachempfinden, was ihnen im Elternhaus vorgelebt wird. Doch das ist nicht der Fall, besteht doch zu den Eltern kaum eine Beziehung. Das Böse kommt vielmehr direkt aus ihren Herzen.
Beim Leser ruft Die Glasfresser eine Reihe von unangenehmen Gefühlen hervor: Entsetzen, Ekel, Verständnislosigkeit. Dies ist ein perverses, ein verstörendes Buch, das den Leser mit hinabreißt in den Abgrund, das Angst macht in seiner Unmenschlichkeit. In einem Lied von Gianna Nannini kommt ein Vergleich vor, der sehr schön und treffend ist: un gelato al veleno, ein Eis aus Gift. So ist dieser aufwühlende, provokante und mutige Roman: sprachlich kunstvoll, geschmackvoll, köstlich gar, inhaltlich bitter, verdorben, giftig. Wie Säure ätzt sich Die Glasfresser ins Gedächtnis – und ist gerade deshalb unglaublich wichtig und lesenswert.
Die Glasfresser ist erschienen in der DVA (ISBN 978-3-421-04447-1, 19,99 Euro).