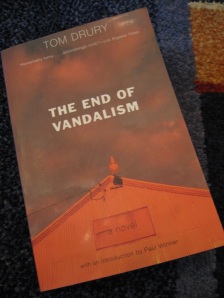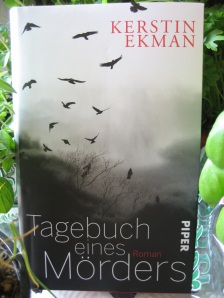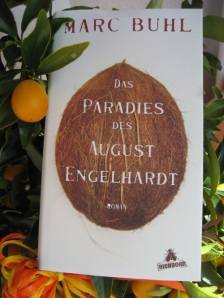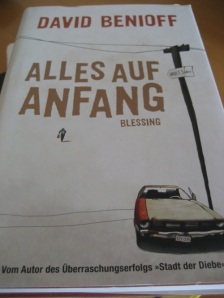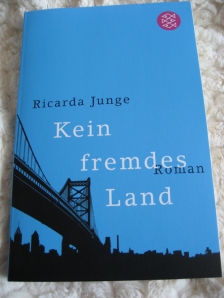“Ich will endlich anfangen, mein Leben zu leben” …
“Ich will endlich anfangen, mein Leben zu leben” …
… so lautet der Vorsatz von Mead, Ex-Genie und Sohn eines Bestatters aus der Kleinstadt. Bisher war sein Leben nämlich in hohem Maße fremdbestimmt, vor allem von Meads ambitionierter Mutter, dem “sechsbeinigen Monster”. Sie wollte stets etwas Besseres für Mead, der eigentlich Theodore heißt, als eine Zukunft im Möbelladen und Bestattungsinstitut von Vater und Onkel. Während seiner gesamten Kindheit und Jugend war Mead daher der typische gemobbte Außenseiter, neben dem in der Cafeteria niemand sitzen wollte, der Insekten in seinem Mittagessen fand und von den Klassenrüpeln bedroht wurde. Nur sein Cousin Percy – körperlich kräftig, baseballbegabt und nicht an guten Noten interessiert – stärkte ihm den Rücken. Mit gerade einmal 15 Jahren schafft Mead es an die Universität von Chicago, wo er ein Mathematikstudium beginnt und sich eingehend mit der Riemann’schen Vermutung beschäftigt, was ihm weltweiten Ruhm einbringen könnte. Doch wenige Tage vor seiner Abschlussprüfung und seinem Vortrag vor renommierten Mathematikern schmeißt Mead alles hin, kehrt nach hause zurück, will bei seinem Vater arbeiten und von der Mathematik nichts mehr wissen. Und alle fragen sich: Was ist geschehen?
Der verführerische Charme der Durchschnittlichkeit ist für den 18-jährigen Mead besonders groß. Seine Klugheit und seine Strebsamkeit machen ihn einsam – und das Leben der anderen, die es gemütlich haben in ihrer Mittelmäßigkeit, erscheint ihm überaus attraktiv. Seine Entscheidung löst bei seinen Eltern und Lehrern Entsetzen aus – zumal Mead sie im Unklaren über die Vorfälle lässt, die ihn dazu gebracht haben, seine große Leidenschaft, die Mathematik, aufzugeben. Erst nach und nach kommt ans Licht, dass der naive Mead aus dem Kaff, der noch nie einen Freund hatte, den falschen Leuten vertraut hat.
Melissa Jacoby hat biografische Teile ihrer eigenen Familiengeschichte in diesen Roman einfließen lassen: Ihr Großvater war Bestatter, ihr Vater ein mathematisches Genie. Meads Erfolge beruhen zwar in meinen Augen mehr auf Fleiß als auf Genialität, die lästigen Neider hat der junge Mann aber sowieso. Der verführerische Charme der Durchschnittlichkeit handelt von Andersartigkeit und Einsamkeit, von Verlust und Trauer, vom Wunsch eines Jugendlichen, den richtigen Lebensweg zu finden. Mead muss stets den hohen Erwartungen der anderen gerecht werden und lernt dabei nicht, auf seine innere Stimme zu hören – bis ihm die eigenen Illusionen plötzlich zerbröseln und er hart auf den Boden der Realität aufschlägt. Er flieht, um sich über seine nächsten Schritte klarzuwerden, und der Leser erfährt in Rückblenden, was den jungen Mathematiker derart aus der Bahn geworfen hat. Melissa Jacoby hat einen leichtfüßig-amüsanten, ereignisreichen Roman mit einem liebenswerten Helden geschrieben. Etwas irritiert bin ich von den Passagen, in denen Mead Gespräche mit Menschen halluziniert, die gar nicht anwesend sind; hier schießt die Autorin meiner Meinung nach ein bisschen übers Ziel hinaus. Davon sollte man sich aber nicht abschrecken lassen, denn insgesamt ist Der verführerische Charme der Durchschnittlichkeit ein lesenswertes Stück Unterhaltungsliteratur, mit einem klassisch amerikanischen Touch über die Moral von Freundschaften und allerhand Einblicken in die Seele eines begabten Teenagers ausgestattet. Gut!
Der verführerische Charme der Durchschnittlichkeit ist erschienen bei Droemer (ISBN 978-3-426-19902-2, 19,99 Euro).