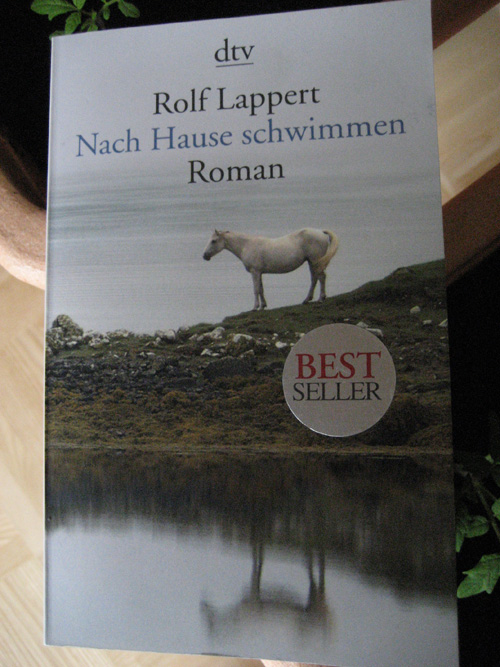 Endlose Langeweile
Endlose Langeweile
Schon nach drei Seiten weiß ich, dass ich Nach Hause schwimmen nicht mögen werde. Und da liegen noch 600 Seiten vor mir. Aber der sture Bücherwurm in mir schafft es nie, ein Buch wegzulegen, auch wenn es mich noch so sehr langweilt. Vielmehr lese ich weiter und versuche zu ergründen, warum mir dieser hochgelobte Roman nicht gefällt. An der Geschichte selbst ist gar nichts auszusetzen: Es geht um Wilbur, dessen Leben bisher alles andere als einfach und angenehm war. Bei der Geburt starb seine Mutter, und so war Wilburs Start nicht der beste. Er wird herumgereicht und wächst unter schwierigen Bedingungen auf – was vielleicht der Grund dafür ist, dass er nicht besonders groß wird. Dass die Frauen, an die er sein kleines Herz hängt, sterben, scheint sein Schicksal zu sein. Aufgenommen wird er von seinen Großeltern, wobei sein Großvater der Welt innerlich längst entschwunden ist. Er hat vor Jahren sein Glück in Amerika gemacht und ist mit viel Gold zurückgekommen – zumindest glaubt das jeder. Seine Großmutter Orla liebt Wilbur abgöttisch, die beiden sind einander sehr nah. Wilbur lernt Cello spielen – und nutzt viele Jahre später eine Reise mit dem Orchester dazu, sich abzusetzen und sich auf die Suche nach seinem Vater zu machen …
Wilburs Geschichte wird aus zwei Perspektiven erzählt: In der Vergangenheit als Bericht und in der vermeintlichen Gegenwart in der Ich-Form von Wilbur selbst, der sich in der psychiatrischen Anstalt befindet. Eine gewisse Aimee, so sagt der Klappentext, zeigt ihm, warum es sich lohnt zu leben. Das ist so nicht richtig, Aimee hat nicht ganz die ihr zugeschriebene Bedeutung: Sie heitert Wilbur auf und schläft mit ihm, aber sie ist selbst mit Problemen beladen und Wilbur irrt auch als er sie bereits kennt noch immer planlos durch sein Leben. Was mir an Nach Hause schwimmen fehlt, ist das Feuer, die Leidenschaft, der Esprit. Dies ist kein Buch, von dem man nicht lassen kann. Aber es ist gut möglich, dass das nur für mich gilt: Denn ich stelle während der Lektüre fest, dass ich wahnsinnig überlesen bin. Die Vatersuche Wilburs erinnert mich sofort an John Irvings Until I find you, dass Wilbur ein Waisenkind ist, lässt mich an Eddies Bastard von William Kowalski denken und die Aggression und Verzweiflung, die Wilbur gegen sich selbst und andere richtet, sind ähnlich geschildert wie in Der Außenseiter von Sadie Jones. Was sagt uns das? Dass ich bereits zu viel gelesen habe. Dass alles irgendwie schon einmal da gewesen ist. Dass Rolf Lappert mit Sicherheit nichts abgeschrieben – aber auch nichts Neues erfunden hat.
Die Geschichte hinter Nach Hause schwimmen fordert mich nicht heraus, sie quält und schmerzt mich nicht, sie unterhält mich nicht, kurz: Sie interessiert mich nicht. Ich spüre nichts. Ich bin angeödet und jedes Mal, wenn ich einen halbwegs guten Satz lese, erleichtert. Nur passiert das in etwa alle 50 Seiten. Am schlimmsten sind die Kapitel in der Ich-Form, in denen auch der Stil wechselt: Wilbur soll betont cool und lässig dargestellt werden, sehr rotzig, sehr abgeklärt. Leider macht ihn das auch unglaublich unausstehlich. Ich denke, dass mein Urteil über diesen Roman extrem subjektiv ist. Das zeigen auch die guten Kritiken und Rezensionen. Ich bin einfach übersättigt, während viele andere Leser einen unbedarfteren Zugang zu diesem Buch finden. Es sei ihnen vergönnt.

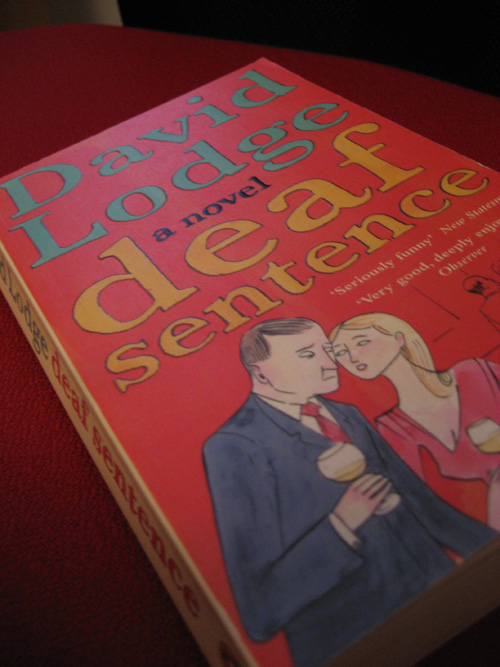
 Alles, was daran gut ist, ist die Idee
Alles, was daran gut ist, ist die Idee