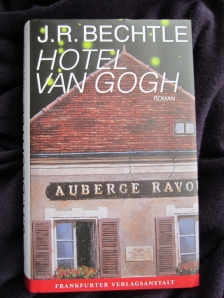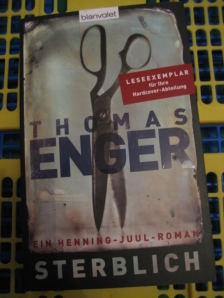Einen Jux wollt‘ er sich machen
Einen Jux wollt‘ er sich machen
„Am Morgen des Weltuntergangs lag Wien wie ausgestorben da.“ Nichts kann die Stadt, das Land, die Welt ausrichten gegen den Kometen, der auf die Erde zurast. Sie haben es versucht, die klugen Wissenschaftler auf der Mondstation – die in einer unkomplizierten Reise erreichbar ist – , aber recht viel mehr, als den Tag des Weltuntergangs auszurechnen, konnten sie nicht tun. Nach wie vor wird Europa von Monarchen beherrscht, das von Wien aus regierte Kaiserreich ist der Nabel der Welt – denn einen Ersten Weltkrieg hat es nie gegeben, auch keinen Zweiten oder irgendeine andere politische Entwicklung, die darauf gefolgt wäre. Amerika ist ein hinterwäldlerischer Kontinent voller Cowboys und Goldgräber. Während k. u. k. Hofastronom Dudu Gottlieb auf dem Mond, einer deutschen Kolonie, weilt und nach einer Lösung für das Kometen-Problem sucht, betrügt seine Frau Barbara ihn mit dem russisch-stämmigen Studenten Alexej, einem Jungspund, der ganz berauscht ist davon, dass er mit dieser Dame von Welt und ihren gesellschaftlich angesehenen Freunden verkehren darf. Soll er es genießen, solange er kann – bevor das Ende kommt.
Der Komet von Hannes Stein ist der pure Wahnwitz. Der deutsche Autor, der in Österreich aufgewachsen ist und in Amerika lebt, hat ein folgenreiches historisches Ereignis genommen – das tödliche Attentat auf Kronprinz Franz Ferdinand 1914, das den Ersten Weltkrieg auslöste – und gestrichen. Franz Ferdinand bleibt am Leben, fährt „wieder z’haus“, und für Hannes Stein eröffnet sich eine große Spielwiese voller Möglichkeiten. Er macht Wien zu Europas Mittelpunkt und verweigert den USA die technische Entwicklung, die Monarchen bleiben an der Macht, der Mond ist eine deutsche Kolonie und in Österreich wimmelt es von Psychoanalytikern, Künstlern, Angehörigen verschiedener Habsburg-Völker und blasierten Wichtigtuern im Dunstkreis des kaiserlichen Hofs. Dieses Buch ist voller Schmäh. Allerdings gibt es, was diesen Schmäh und mich betrifft, ein kleines Problem. Ich kann den Humor sehen, er liegt groß und deutlich und rot angemalt zwischen all den Seiten vor mir, er ruft mir zu, dass ich lachen soll, allein – ich kann nicht. Humor, die zugleich einfachste und komplizierteste Sache, ist allumfassend und individuell. Und während Hannes Stein mir Witz nach Witz erzählt, finde ich kaum einen davon witzig.
Dabei sollte mir als Österreicherin dieser spezifische und beißend perfide Humor eigentlich liegen, aber der Roman ist mir zu schwülstig, zu gewollt, ich fühle mich, als lauere auf jeder Seite eine neue Anspielung auf Geschichtliches oder Philosophisches wie ein Prügel, der mir das Lachen aufzwingen soll. Ich reagiere seltsam rebellisch und schmunzle höchstens. Manchmal frage ich mich auch, ob ich für den einen oder anderen satirischen Hinweis zu dumm und ungebildet bin – auch nicht schön. Die Ausgangsidee ist grandios, das Buch und ich kommen jedoch nicht in Schwung. Hannes Stein hat einen sehr ausschweifenden Stil, ergeht sich in langatmigen Wortergüssen, schreibt schwierige Briefe und lässt die Figuren mäßig interessante Dialoge führen. Ich mag Hannes Steins Fantasie und Kreativität, den Ehrgeiz, mit dem er seine Parallelwelt bis ins Detail geplant hat. Sie ist herrlich absurd und abwegig, wobei sie natürlich ganz genau so beschaffen sein könnte – hätte das 20. Jahrhundert einen anderen geschichtlichen Weg genommen. Mich hat der Ausflug in diese Parallelwelt nicht ganz so begeistert wie erhofft, aber bei vielen anderen Lesern wird das bestimmt gelingen: Die Zeit und Profil beispielsweise sind voll des Lobes, Mara von buzzaldrins Bücher fand auch Gefallen am Roman.
Durchgekaut und einverleibt. Von diesem Buch bleibt …
… fürs Auge: Wien bei Nacht, bedroht von einem Blumentopf.
… fürs Hirn: viel, viel Denkarbeit, Politik, Weltgeschichte, Judentum, endlose Arroganz und bergeweise Ironie.
… fürs Herz: ein bisschen Sex und die Schwärmerei eines jungen Mannes.
… fürs Gedächtnis: am ehesten große Verwirrung.
Der Komet von Hannes Stein ist erschienen im Galiani Verlag (ISBN 978-3-86971-067-9, 272 Seiten, 18,99 Euro).
 Snack für zwischendurch – Kurzrezension
Snack für zwischendurch – Kurzrezension