 „Boah, was stinkt das. Ist hier ’ne Douglas-Verkäuferin gestorben, oder was?“
„Boah, was stinkt das. Ist hier ’ne Douglas-Verkäuferin gestorben, oder was?“
Giulia Becker ist eine großartige Frau. Ich folge ihr schon lange auf Twitter und himmle sie an. Dazu muss man wissen: Twitter ist nicht wie Instagram, dort fliegen einem die Follower und die Herzen nicht so zu, man muss sie sich hart erarbeiten. Giulia Becker ist außerdem im Autorenteam von Jan Böhmermann, das Witzigsein ist also ihr Beruf. Sie steht auf Bühnen und singt, sie ist eine Präsenz. Und sie kann schreiben – das hat sie mit ihrem Debütroman bewiesen. Der ist nämlich eine Rarität: Er ist witzig – obwohl er von einer Deutschen stammt.
Tschuldigung, kleiner liebevoller Seitenhieb unter Nachbarn. So oder so hat mich schon die allererste Seite des Buchs überzeugt: Da stirbt ein Hund, okay, das ist vielleicht per se nicht so witzig, aber dieser Hund heißt Mandarine Schatzi (und erstickt in einer Punica-Flasche). Diese erste Seite ist am Punkt, ich hab sofort gelacht, ich hab Giulia geschrieben, wie gut ich den Namen finde, woraufhin sie mir geantwortet hat, dass es Mandarine Schatzi wirklich gibt und dieser Hund einen eigenen Facebook-Account hat. Sofern euch das allein noch nicht überzeugt, ich hab noch mehr zu bieten (und Giulia sowieso): Da wäre zum Beispiel noch Silke. Sie hat vor Jahren die Notbremse im Zug gezogen, ist seither wegen der Schadensersatzforderungen verschuldet und muss in der Bahnhofsmission Sozialstunden abarbeiten. Sie ist eine Frau mit Herz, die sich aufopfert für die anderen:
„Wenn Silke zuhörte, schien es, als fühlte sie sich in die Geschichten hinein, verschwand darin regelrecht, und war am Ende nicht selten aufgebrauchter als die erzählende Person selbst.“
Und Leute, denen sie zuhört, gibt es einige, und kennengelernt haben sie sich in der Selbsthilfegruppe der Caritas für durch Eigenverschulden in Not Geratene: Willy-Martin zum Beispiel, der sich um Tauben kümmert und beim Online-Kniffel die Knochenbrecherin Kerstin kennenlernt, die quirlige Renate, Frauchen von Mandarine Schatzi und TV-Shopping-süchtig, außerdem die alte Frau Goebel, die nur noch einen Wunsch hat: Sie will die Papageien im Badeparadies Tropical Island sehen. Und so brechen alle diese Gestalten zu einem Roadtrip auf. Das ist natürlich das Beste, was einem witzigen Roman passieren kann, nein, das ist es, was ein witziger Roman haben muss: leicht angeknackste, kauzige, schrullige Figuren, mit denen man fiebert und leidet und lacht.
„Frau Goebel schläft, wahrscheinlich. So ganz sicher kann man das bei ihr nie sagen. Sie wirkt wie jemand, der schon lange müde ist, aber permanent am Einschlafen gehindert wird.“
I feel so related.
Das Leben ist eins der Härtesten von Giulia Becker ist erschienen im Rowohlt Verlag (ISBN 978-3-498-00689-1, 224 Seiten, 20 Euro.)
 „Ist doch nicht normal, so etwas zu erfinden“
„Ist doch nicht normal, so etwas zu erfinden“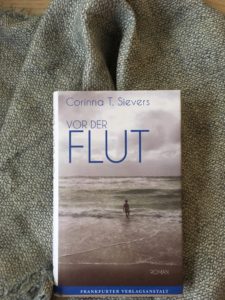 „Ich wandele Einsamkeit in Lust und entkomme auf diese Weise dem Schmerz“
„Ich wandele Einsamkeit in Lust und entkomme auf diese Weise dem Schmerz“ „Unsere Angst ist weniger die Angst vor dem Tod als die Angst, nicht richtig zu leben“
„Unsere Angst ist weniger die Angst vor dem Tod als die Angst, nicht richtig zu leben“ „Sommerabende versöhnen mich immer mit dem Leben“
„Sommerabende versöhnen mich immer mit dem Leben“ „Du wirst leicht wie eine Feder, alles ist rund und weich und schön“
„Du wirst leicht wie eine Feder, alles ist rund und weich und schön“ „Nishinos Kuss schloss alles ein, was zu unseren vierzehn Jahren gehörte, und schloss zugleich alles aus. Wir küssten uns aus Leibeskräften“
„Nishinos Kuss schloss alles ein, was zu unseren vierzehn Jahren gehörte, und schloss zugleich alles aus. Wir küssten uns aus Leibeskräften“ „So ist diese Welt auch. Sie ist nicht nur Krieg und Gier und Ausrottung der Arten. Sie besteht auch aus Ketten von Menschen, die aufeinander aufpassen“
„So ist diese Welt auch. Sie ist nicht nur Krieg und Gier und Ausrottung der Arten. Sie besteht auch aus Ketten von Menschen, die aufeinander aufpassen“ „Jemandem wie Ihnen möchte man im Dunkeln nicht begegnen“
„Jemandem wie Ihnen möchte man im Dunkeln nicht begegnen“ Es ist mal wieder Zeit für #5aus300! Ich besitze nur ein Bücherregal. Und behalte ausschließlich Bücher, die so besonders sind, dass ihnen ein Platz in diesem Regal gebührt. Aber welche sind das? Seht selbst.
Es ist mal wieder Zeit für #5aus300! Ich besitze nur ein Bücherregal. Und behalte ausschließlich Bücher, die so besonders sind, dass ihnen ein Platz in diesem Regal gebührt. Aber welche sind das? Seht selbst.