 „Er war dieser Frau offenbar vollkommen ausgeliefert“
„Er war dieser Frau offenbar vollkommen ausgeliefert“
„Aber wieso wollt ihr die Welt beherrschen? Ich dachte, das sei eine Idee der Antisemiten?“
„Ist es auch! Aber wir finden sie gut und wollen sie in die Tat umsetzen.“
Das bekommt der überraschte Mordechai Wolkenbruch zu hören, und zwar in dem Kibbuz, in den er gebracht wurde, nachdem seine jüdische Familie mit ihm gebrochen hat – wegen seiner Liebe zu einer Schickse, von der Thomas Meyer auf wunderbar unterhaltsame Weise in Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse erzählt hat (das kürzlich von Netflix verfilmt wurde!). Im zweiten Teil Spektakels rund um Motti, wie seine jüdische Mame ihn nennt, artet alles sehr schnell aus: Die Juden möchten die Weltherrschaft an sich reißen, und in einem geheimen Bunker in den Alpen leben Nazis, die sich bei Kriegende dort versteckt haben, um eines Tages den Endsieg doch noch herbeizuführen. Was natürlich einhergehen würde mit – achja, der Weltherrschaft. Kann es noch absurder sein? Ja. Weil die Nazis eine Agentin nach Israel entsenden, die den Anführer des Weltjudentums – unseren Mordechai Wolkenbruch, mittlerweile Mickey genannt und Leiter eines Orangen-Export-Unternehmens – zu ermorden. Und spätestens ab da geraten die Dinge wirklich außer Kontrolle.
Ich glaube, Thomas Meyer hat sich bei diesem Buch gedacht: Scheiß drauf. Ich mach es einfach, ohne Rücksicht auf Verluste. Was für ein überbordend verrückter, lustiger, hochgradig seltsamer Roman das geworden ist! Ich schwanke auf jeder zweiten Seite zwischen „haha, wow, okay, verdammt gut“ und „what the fuck, das kann nicht sein Ernst sein“. Eine Hassmaschine, die das Internet zu einem Ort der verbalen Gewalt macht, ein Volksrechnerlein, mit dem man telefonieren und auf Instagram posten kann, jüdische Boys, die mit sexy Fotos Orangen verkaufen, und die unberechenbare Macht von Alexa – ehrlich, das alles zusammenzumengen, ist entweder krank oder genial. Ich kann mich bis zum Ende nicht entscheiden, und denke deshalb: Es ist beides. Ein großer Spaß, ein waghalsiges Leseabenteuer, ein vor Originalität sprühendes Buch, bei dem man mit Sicherheit mehr als einmal nur den Kopf schüttelt. Ich frage mich, ob es da noch einen dritten Teil geben kann, denn ganz ehrlich: NOCH verrückter geht es gar nicht.
Wolkenbruchs waghalsiges Stelldichein mit der Spionin von Thomas Meyer ist erschienen bei Diogenes (ISBN 978-3-257-07080-4, 288 Seiten, 24 Euro).
 „Das Ting macht dich zum perfekten Menschen“
„Das Ting macht dich zum perfekten Menschen“ „Ja, wir sitzen auf diesem Planeten fest, und wir werden ihn nicht lebendig verlassen“
„Ja, wir sitzen auf diesem Planeten fest, und wir werden ihn nicht lebendig verlassen“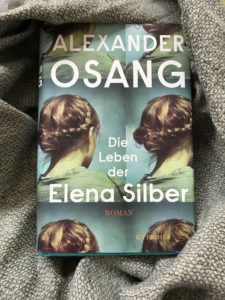 „Ich erinnere mich an alle Jahreszeiten. Vor allem an den Winter“
„Ich erinnere mich an alle Jahreszeiten. Vor allem an den Winter“ „Das Leben war das, was vorüber war“
„Das Leben war das, was vorüber war“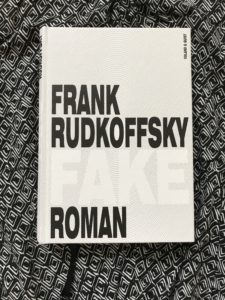 „Du wirst lachen: Ich trolle“
„Du wirst lachen: Ich trolle“ „Der Himmel ein Viereck, bevor sie die Augen schließt“
„Der Himmel ein Viereck, bevor sie die Augen schließt“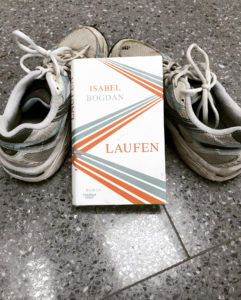 „Wie soll ich denn etwas wollen, wie soll ich Spaß haben, wie soll ich überhaupt leben“
„Wie soll ich denn etwas wollen, wie soll ich Spaß haben, wie soll ich überhaupt leben“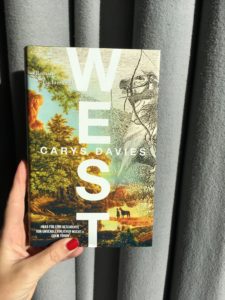 „Komm ins Haus, mein Kind, mach die Tür hinter dir zu und vergiss ihn“
„Komm ins Haus, mein Kind, mach die Tür hinter dir zu und vergiss ihn“ „Die Reue macht die Dinge schwer, gleichzeitig einzigartig“
„Die Reue macht die Dinge schwer, gleichzeitig einzigartig“