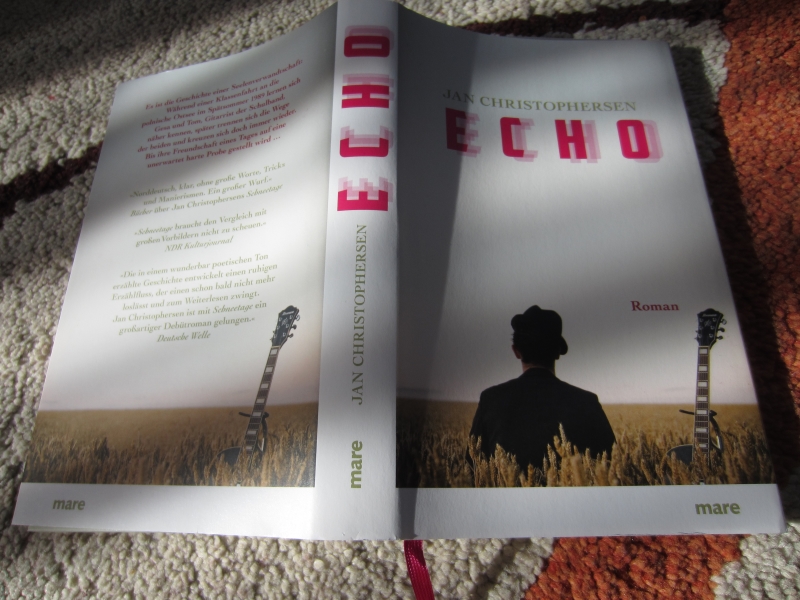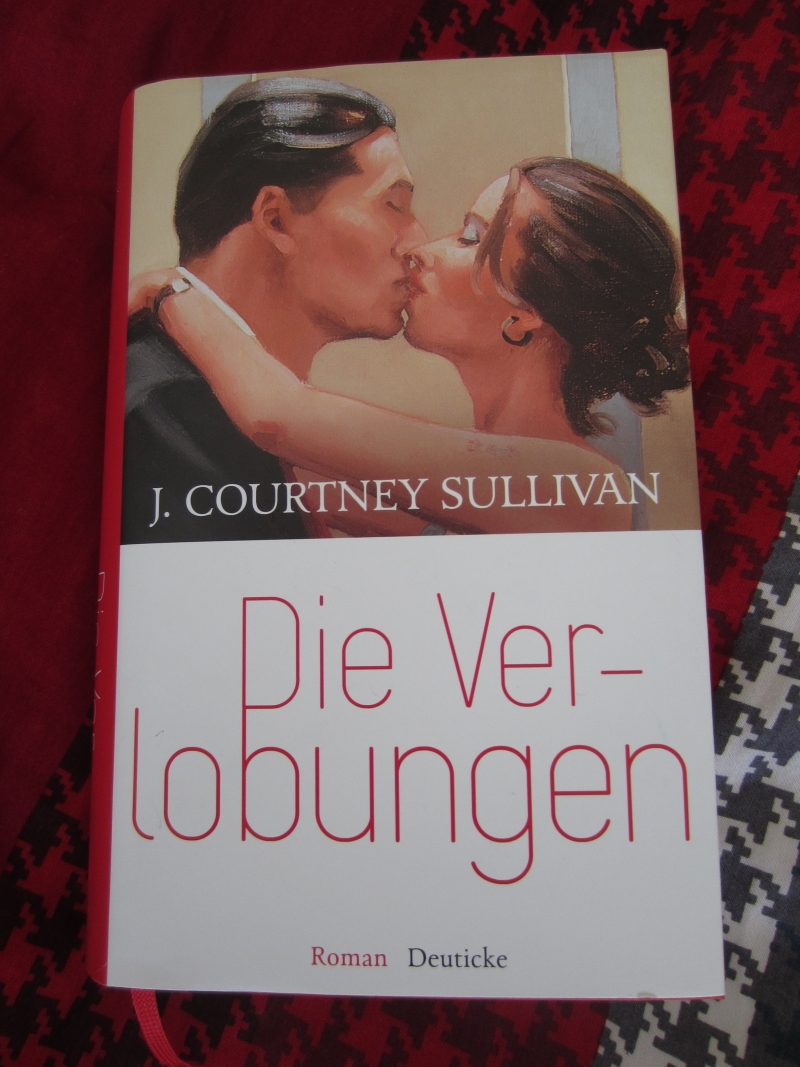„Ich bin sehr lichtempfindlich. Psychisch, meine ich“
„Ich bin sehr lichtempfindlich. Psychisch, meine ich“
Robert und Odile streiten im Supermarkt an der Käsetheke und nehmen einen banalen Zwischenfall zum Anlass, die aufgestaute Verachtung herauszukotzen. Eine Ehe, in der Lähmung und Ratlosigkeit vorherrschen, führen auch Ernest und Jeanette. Arzt Philip dagegen ist homosexuell und bezahlt für den Sex, weil ihn das anturnt. Pascaline und Lionel sind verzweifelt, weil ihr Sohn sich für Celine Dion hält – und alle Welt das auch noch witzig findet. Hélène trifft im Alter ihren Liebhaber aus jungen Jahren wieder, den sie schon damals abstoßend fand – und dem sie auch heute trotzdem folgt, einfach so, aus dem Bus hinaus. Was all diese Menschen verbindet? Sie sind miteinander verwandt oder befreundet. Sie sind Schauspieler, Hausfrauen, Journalisten, Ärzte – und allesamt zutiefst unglücklich. Was das ist, Glück? Nun. Es existiert nicht.
Als ich Glücklich die Glücklichen von Yasmina Reza beginne, sauge ich einmal scharf die Luft durch die Zähne ein. Weil ich sofort weiß: Das hier wird richtig gut. Ich bin schon nach wenigen Seiten wie elektrisiert, ein fieses Lächeln setzt sich in mein Gesicht, und mein Faible für schwarzen Humor und Sarkasmus jubelt begeistert: Mehr, mehr, meeehr! Und ich bekomme mehr – eine ordentliche Dosis Ironie, Abgebrühtheit, Resignation. Yasmina Reza hat eine unglaublich spitze Feder, und ich mache innerlich einen Kniefall vor ihr. Auf sehr ungewöhnliche Art durchleuchtet sie in diesem Roman, der keine durchgängige Story bietet, sondern in viele Perspektiven gesplittet ist, einen kleinen Kosmos: Eltern, Großeltern, Freunde, verheiratet, verliebt, einsam, voller Hass, voller Klagen. Jeder hat ein anderes Päckchen zu tragen, keiner trägt es mit Würde: Es wird nach Herzenslust lamentiert. Das ist so bitter und niederschmetternd – einfach großartig! Und bei all der Düsternis trotzdem noch überraschend amüsant.
Passenderweise habe ich vor wenigen Tagen zufällig Der Gott des Gemetzels gesehen, einen Film von Roman Polanski nach einem Stück von Yasmina Reza, die als Regisseurin, Schauspielerin und Theaterautorin agiert, mit Kate Winslet, Jodie Foster und dem von mir sehr verehrten Christopher Waltz. Wie zwei Ehepaare innerhalb kürzester Zeit die Fassung verlieren und ihre wahren Gedanken offenbaren, ist herrlich. Ich glaube, Yesmina Reza ist just my kind of girl. Ich steh drauf, wie boshaft sie mit den vielen Figuren in Glücklich die Glücklichen umgeht, und dass die einzelnen Kapitel so kurz sind, finde ich grandios. Die Autorin öffnet mir ein Fenster nach dem anderen, sagt: Schau, schau, was die da treiben, armselige Gestalten, ich schaue, sie kichert mir ins Ohr, schlägt das Fenster zu, bamm. Zusammengesetzt ergeben all diese kurz erhaschten Blicke das Bild einer Gesellschaft, in der Monogamie vorherrscht, aber hinterrücks betrogen und gelogen wird, und in der Ehen aufrechterhalten werden, in denen Mann und Frau nur noch auf den erlösenden Tod warten – egal, ob den eigenen oder den des anderen. Absolut genial!
Bestes Zitat: „Ich möchte gern zwischen den Hunderten Körpern, die ich begehre, auf den einen stoßen, dem es gegeben ist, mich zu verletzen. Selbst von weitem, selbst abweisend, selbst auf einem Bett hingestreckt, mir den Rücken zukehrend. Auf einen Liebhaber, mit einer unkenntlichen Klinge gerüstet, die mir die Haut abzieht. Das ist die Signatur der Liebe.“
Glücklich die Glücklichen von Yasmina Reza ist erschienen im Hanser Verlag (ISBN 978-3-446-24482-5, 176 Seiten, 17,90 Euro).
Was ihr tun könnt:
Euch die Leseprobe runterladen.
Ein Interview mit der Autorin lesen.
Das Buch bei ocelot.de bestellen.
Den Trailer zu Der Gott des Gemetzels anschauen.
Was andere über dieses Buch sagen:
“Das Glück ist da, wo man es am wenigsten erwartet. Das ist das eigentlich Charmante an diesem Buch. Und das was beim Lesen glücklich macht”, schreibt Spiegel Online.
“Dieses Buch enthält Sprengstoff!”, heißt es bei ndr.de.
“Dabei sind es gerade die Momente des Verstoßes gegen die ungeschriebenen Regeln des Miteinanders, in denen gleichermaßen der größte Witz liegt und die größte Freiheit”, erklärt die FAZ.