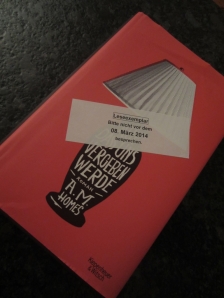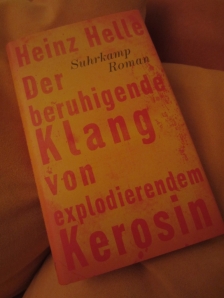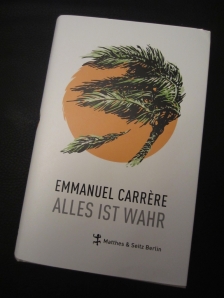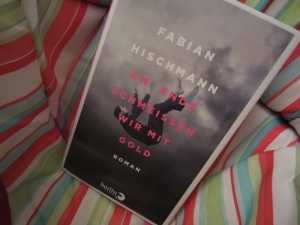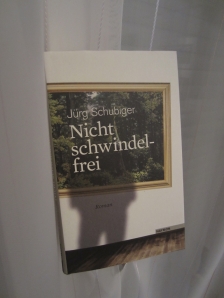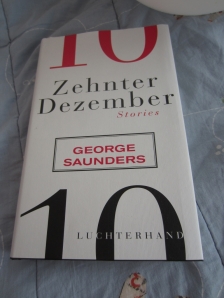 Zehn visionäre Geschichten
Zehn visionäre Geschichten
Stell dir vor, du hast ein MobiPak in deinem Körper, über das beliebige Substanzen in dein Blut gepumpt werden können: Verbaluce zum Beispiel, damit du alles sagen und dich eloquent ausdrücken kannst. Oder SoIsBrav, das dich willenlos macht. Oder Dunkelfloxx, das dich verzweifeln lässt und traurig macht, so traurig, dass du dich umbringst. All das erlebt der Gefängnisinsasse Jeff, der als Versuchskaninchen in George Saunders‘ Geschichte Flucht aus dem Spinnenkopf an einer Experimentreihe teilnehmen muss. Das Ziel: chemisch beeinflussen zu können, ob ein Mensch einen anderen liebt. Er ist ausgeliefert, so wie Alison Pope, ein Teenager, der überfallen und aus dem eigenen Haus entführt wird – beobachtet vom Nachbarsjungen Kyle, der, um sie zu retten, sämtliche Regeln seiner Eltern brechen müsste. Dafür könnte er an dem Entführer all seine aufgestaute Wut auslassen … Wütend ist auch der Kriegsveterinär, der zu seiner verkorksten Familie in die USA zurückkehrt: Seine Frau wohnt mit den Kindern bei einem anderen, seine Schwester lässt ihn nicht einmal ihr Baby halten, seine Mutter hat einen neuen Freund und muss ihr Haus räumen. Ist schon ziemlich beschissen, das Leben …
… vor allem für die Figuren in den zehn Short Storys von George Saunders. In einer Obstschale voller Äpfel sind sie die Früchte mit den angeschlagenen Stellen. Die schon ein wenig faulig sind. Die keiner mehr will. George Saunders‘ Kurzgeschichten sind dystopisch, verwirrend, böse, amüsant, traurig. Sie spielen in der Gegenwart oder einer Art Zukunft, die sich unheimlich real anfühlt – in der Menschen beispielsweise daran arbeiten, das Menschsein selbst zu beherrschen. Die Charaktere in diesen verrückten Storys sind alt und jung, manchmal dumm, immer ein wenig hilflos, immer ein wenig verzweifelt. Und der Autor hat nicht das geringste Mitleid mit ihnen, lässt sie im Spinnennetz seiner Worte zappeln wie kleine, harmlose Eintagsfliegen, lässt sie scheitern an einer grausamen Welt.
Der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller und Englisch-Universitätsprofessor George Saunders setzt mir mit Zehnter Dezember ganz schön zu. Nach den ersten drei Geschichten brauche ich erst mal eine Verschnaufpause. Er seziert unsere Gesellschaft auf sprachlich derbe Weise, mit Elementen, die wie Science-Fiction anmuten, aber auch etwas unheimlich Reales an sich haben. Nicht jede Geschichte liest sich flüssig, im Gegenteil, sperrig sind sie, hölzern, unwillig, praktisch das Gegenteil von poetisch. Fast so, als wollten sie mir gar nicht gefallen, als kümmerten sie sich nicht um mich, den Leser. Sie lassen sich von mir betrachten, aber nicht betreten, und ich finde bei mehreren Storys nicht den geringsten Zugang zu den Erzählern. Deshalb stehe ich hinter einem Absperrband und recke neugierig den Hals, um irgendwas von den abstrusen Vorgängen zu erkennen, die sich da vorn irgendwo abspielen. Diese Kurztexte sind wahnwitzig, stellenweise unverständlich, aber sie scheren sich nicht darum – und das macht sie wiederum so gut.
Zehnter Dezember von George Saunders ist erschienen im Luchterhand Literaturverlag (ISBN 978-3-630-87427-2, 272 Seiten, 19,99 Euro).
Was ihr tun könnt:
Mit einer Leseprobe in das Buch hineinschmökern.
Die Rezensionsnotizen im Perlentaucher lesen.
Euch eine hymnische Besprechung auf spiegel.de zu Gemüte führen.
Die sehr begeisterte Rezension von Sophie lesen.
Das Buch auf ocelot.de bestellen.
Andere hervorragende Kurzgeschichten:
John von Düffel: Wassererzählungen
Amy Hempel: Die Ernte
Molly McCloskey: Liebe